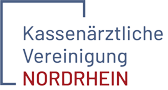Das im Januar 2016 verabschiedete E-Health-Gesetz sieht vor, dass eine Telematikinfrastruktur (TI) geschaffen wird, welche alle Beteiligten im Gesundheitswesen sektorenübergreifend vernetzen soll, damit diese sicher und schnell miteinander kommunizieren können. Die TI ist ein geschlossenes Netz, zu dem nur registrierte Nutzer mit einem elektronischen Ausweis Zugang erhalten.
Den Aufbau der TI regelt das Sozialgesetzbuch V.
Mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und dem Aufbau einer sicheren, einrichtungsübergreifenden Kommunikationsinfrastruktur im Gesundheitswesen soll die Grundlage für einen sicheren Austausch wichtiger medizinischer Daten geschaffen werden. Außerdem steht der Nutzen für die Patienten im Fokus. Sie sollen beispielsweise in die Lage versetzt werden, ihren Ärzten und Psychotherapeuten wichtige Gesundheitsdaten verfügbar zu machen. Da es sich im Gesundheitswesen um sehr sensible und vertrauenswürdige Daten handelt, hat der Datenschutz oberste Priorität.
Ihr Softwarehaus ist Ihr erster Ansprechpartner für die Bestellung der Komponenten sowie bei Fragen zur Installation. Klären Sie vor Vertragsunterschrift und Vereinbarung des Installationstermins, ob alle notwendigen Komponenten wie Konnektor, VPN-Zugangsdienst, stationärer Kartenterminal und Praxisausweis (SMC-B) und eHBA G2 lieferbar sind.
Wir empfehlen allen Praxen, vor dem Kauf von Komponenten und Diensten das Preis-Leistungs-Verhältnis und die vertraglichen Bedingungen ihres Anbieters genau zu prüfen. Es wird nicht der tatsächliche Rechnungsbetrag erstattet, sondern ausschließlich die auf Basis der TI-Finanzierungsvereinbarung festgelegten Pauschalen (siehe Finanzierung).
Betreiber der TI ist die gematik GmbH mit Sitz in Berlin. Mehrheitsgesellschafter (51%) ist das Bundesministerium für Gesundheit. 49% der Anteile werden von verschiedenen Gesellschaftern getragen (Verbände, KV, Krankenkassen, etc.).
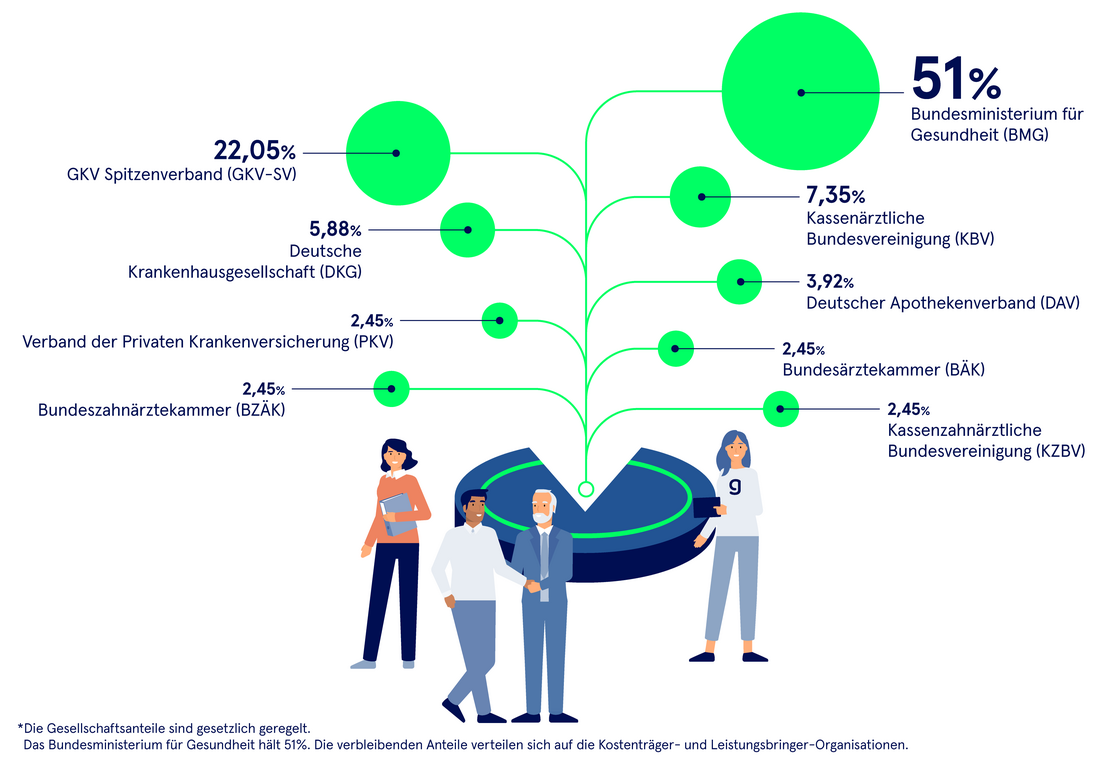
Quelle: gematik GmbH
Hier finden Sie umfangreiche Informationen über und von der gematik.
Die Einführung der TI begann 2017 mit dem Basisrollout. Seit dem sind sukzessive weitere Anwendungen hinzugekommen, bzw. werden in den nächsten Jahren integriert.
- Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) – 2017
- Kommunikation im Medizinwesen (KIM) – 2020
- Notfalldatenmanagement (NFDM) – 2020
- elektronischer Medikationsplan (eMP) – 2020
- elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) – 2021
- elektronische Patientenakte (ePA) – 2021
- elektronische Rezept (eRezept) – 2022
- medizinische Informationsobjekte (MIO) – 2022
- TI-Messenger (TIM) – 2024
Einige Anwendungen sind für die Versicherten freiwillig (NFDM, eMP, ePA, MIO, TIM) – andere im Rahmen der Behandlung notwendig (VSDM, eAU, eRezept).
Ärzte, Psychotherapeuten, Zahnärzte, Krankenhäuser und Apotheken mussten sich bis Anfang 2021 zu unterschiedlichen Terminen verpflichtend an die TI anbinden.
Weitere Leistungserbringer – wie z. B. Pflegeeinrichtungen, Physiotherapeuten oder Hebammen – werden mittelfristig ebenfalls angeschlossen werden. Eine Finanzierungsvereinbarung hierzu liegt noch nicht vor.
Seit 2019 ist die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur für Praxen verpflichtend.
Bei Praxisneugründungen und -übernahmen muss die Anbindung der TI im Laufe des ersten Quartals der Niederlassung durchgeführt werden.
Nach dem SGB V sind Praxen verpflichtet, sich an die TI anzuschließen. Praxen, die nicht an die TI angeschlossen sind, erhalten eine Honorarkürzungen in Höhe von 3,5 Prozent. Sollten Sie an die TI angeschlossen sein, aber die ePA- und eRezept Funktionalität nicht einführen, wird das Honorar jeweils um 1 Prozent gekürzt.
Die KV Nordrhein informiert auf ihrer Homepage www.kvno.de, über die Website ti.kvno.de, im Rahmen ihrer Veranstaltungen sowie in unserer Mitgliederzeitschrift KVNO aktuell über die Entwicklung der Telematik-Infrastruktur (TI).
Darüber hinaus können Sie sich an unsere IT-Hotline, sowie an die IT-Beraterinnen und IT-Berater der KV Nordrhein wenden (Kontaktinformationen).
Achten Sie hier bitte auf die Informationen Ihrer PVS-Anbieter und der KVNO-Nordrhein. Sowohl gesetzliche, technische als auch organisatorische Rahmenbedingungen bedingen den richtigen Zeitpunkt.
Gesetzlich verpflichtend sind der generelle Anschluss an die TI (seit 2019), die Verfügbarkeit der ePA (1. Juli 2021), die eAU (1. Oktober 2021) und das eRezept (1. Januar 2024), KIM (1. März 2024), eArztbrief (1. April 2024).
Außerdem sind die Module NFDM und eMP für Vertragsarztpraxen seit dem 19. Oktober 2022 verpflichtend.
Allgemeine Erklärvideos von der KVNO, der gematik und der KBV zu den neuen TI-Anwendungen finden Sie in unserer Mediathek. Erklärvideos für das Anlegen der Datensätze in Ihrer Praxissoftware werden in der Regel auf der Webseite Ihres Praxisverwaltungssystem-Anbieters angeboten.
Apotheken werden Zugriff auf den eMP (z. B. zur Erfassung selbst erworbener Medikamente), das eRezept und später auch auf die ePA (sofern der Patient der Apotheke einen Zugriff erteilt) haben.
Die Telematik-Infrastruktur setzt sich aus einer Vielzahl von technischen Komponenten und Fachdiensten zusammen. Wie in jedem technischen Umfeld kann es auch hier zu Einschränkungen der Verfügbarkeit kommen, die natürlich möglichst klein gehalten werden soll.
Um in einem Fehlerfall schnell herausfinden zu können, ob die Telematik-Infrastruktur Auslöser des Problems ist, empfiehlt sich ein Blick auf die Status-Seite der gematik.
Alternativ können Sie sich auch den Whatsapp Kanal der gematik abonnieren:

TI-Störungen abonnieren (Wahtsapp)
Grundsätzlich ist jeder, der Daten verarbeitet, auch für diese verantwortlich, egal, um welche Daten es sich handelt – digital oder analog. In Bezug auf die Telematik-Infrastruktur (TI) ist hierbei entscheidend, wo sich ein möglicher Angriff auf die Daten ereignet.
Sollte es aufgrund fehlender Datenschutzmaßnahmen innerhalb des Praxisnetzwerks (zum Beispiel fehlende Absicherung der Hard- oder Software mittels Firewall, Zugriffsbeschränkung oder Ähnliches) zu einem Missbrauch kommen, ist die Praxis bzw. der verantwortliche Arzt/Träger zur Rechenschaft zu ziehen. Dies ist unabhängig von der TI.
Handelt es sich um Sicherheitslücken in der zentralen TI, sind die Betreiber der zentralen Dienste (gematik) verantwortlich – auch wenn diese Lücken bis in die Praxis reichen. Ab dem Konnektor ist die Gematik verantwortlich. Es muss sichergestellt sein, dass der Konnektor nach Vorgaben der Gematik installiert wurde. Dies erfolgt durch Ihren Systembetreuer, der die Installation durchführt und Ihnen das Installationsprotokoll zu Verfügung stellt.
Die TI besteht aus einer Vielzahl von Komponenten, Diensten und Anwendungen. Diese werden von den Herstellern und Anbietern nach von der gematik definierten Vorgaben und Spezifikationen entwickelt bzw. betrieben. Dabei spielen Datenschutz und Sicherheit von Anfang an eine entscheidende Rolle. Die gematik und ihre Partner geben hier höchste Standards vor und sorgen so für Datenschutz und Sicherheit von Anfang an.
Beim Datenschutz arbeitet die gematik eng mit dem oder der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) zusammen. Unser Partner im Bereich Datensicherheit ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). So legt das BSI Vorgaben und Maßnahmen für einzelne TI-Komponenten fest.
Ein Verbindungsaufbau in die TI erfolgt immer aus dem PVS der Ärzte, Zahnärzte und Apotheker über den sogenannten Konnektor. Dieser verschlüsselt und koordiniert die Kommunikation zwischen Praxissoftware, elektronischer Gesundheitskarte, Heilberufsausweis und TI. Gleichzeitig schützt der Konnektor auch die TI vor beispielsweise Schadsoftware in der Arztpraxis.
Er erreicht diese grundlegenden Sicherheitseigenschaften auf der Netzebene durch Firewall-Funktionen, durch die Prüfung der Integrität und Authentizität der Kommunikationspartner und auf der Anwendungsebene durch eine Strukturprüfung der eingehenden Daten.
Daten verlassen eine Arztpraxis also nur, wenn sie für die Übertragung durch die TI verschlüsselt wurden. Unberechtigte können die verschlüsselten Daten während der Übertragung nicht lesen. Es dürfen nur berechtigte Personen auf die Daten des Versicherten zugreifen. Technisch und gesetzlich ist dies durch entsprechende Heilberufs- und Berufsausweise bzw. Ausweise der medizinischen Einrichtungen gewährleistet.
Die Versicherten haben die Hoheit über ihre Daten in der elektronischen Patientenakte (ePA) und können den Zugriff für Praxen gezielt freigeben. Dieser erfolgt durch Aushändigung und Freischaltung der eGK oder auch durch Vergabe einer Berechtigung für den Zugriff. Die Daten der Versicherten werden auf der Gesundheitskarte versichertenindividuell verschlüsselt (NFDM, eMP). Für Unberechtigte bleiben diese Daten unlesbar, da sie nur mit der eGK einer Person zugeordnet werden können.
Durchgeführte Gutachten und Analysen der Sicherheitsarchitektur bestätigen das hohe Schutzniveau für die medizinischen Daten. Der Zugang über die Gesundheitskarte und die Verschlüsselungs- und Anonymisierungstechniken sichern das Selbstbestimmungsrecht der Versicherten.
Das Praxisnetzwerk und die damit verbundenen technischen Komponenten bedürfen natürlich eigener Überlegungen zum Thema IT-Sicherheit und Datenschutz.
Die DSGVO enthält in Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 2 Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber, unter anderem im Sozialleistungsbereich sowie im Bereich der Gesundheitsversorgung. Der nationale Gesetzgeber darf also insbesondere im SGB eigene bzw. spezifische Regelungen schaffen bzw. diese beibehalten.
Das VSDM ist in § 291 Absatz 2b SGB V geregelt. Satz 2 dieser Vorschrift erlegt den Leistungserbringern grundsätzlich die Pflicht auf, einen Abgleich der Versichertenstammdaten unter Nutzung des angebotenen Dienstes durchzuführen. Diese Verpflichtung stellt gleichzeitig die gesetzliche Übermittlungsbefugnis der hierfür erforderlichen Daten dar. Nachdem die Datenübermittlung gesetzlich vorgegeben ist, bedarf es hierfür keiner Patienteneinwilligung. Im Übrigen ist die Nichtdurchführung des VSDM über § 291 Absatz 2b Satz 14 SGB V zulasten des Arztes sanktioniert. Allein dieser Umstand würde bereits zu einer Übermittlungsbefugnis nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO führen.
Es gibt keine Rechtsvorschrift in der DSGVO, die eine Einsichtsmöglichkeit in Daten-/ Übermittlungsprotokolle vorschreibt. Nach § 291 Absatz 2b Satz 11 SGB V ist die Durchführung der VSDM-Prüfung allerdings auf der eGK zu speichern. Ferner ist die Durchführung der Prüfung nach Satz 12 dieser Vorschrift der zuständigen KV mit den Abrechnungsdaten mitzuteilen. Der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO betrifft nur die in der Praxis gespeicherten Daten (hier zum Beispiel VSDM durchgeführt) sowie die Kategorien der Empfänger von Daten – nicht aber die vorgenannten Protokolle.
Empfänger der Daten im Rahmen der VSDM-Prüfung ist der VSDM-Fachdienst innerhalb der TI bzw. die Krankenkasse des Versicherten. Über die Datenverarbeitung beim Empfänger sind die Ärzte und Psychotherapeuten nicht auskunftspflichtig.
Mit dem Digitale–Versorgung–und–Pflege–Modernisierungs–Gesetz (DVPMG) von Juni 2021übernimmt der Gesetzgeber für die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Komponenten der dezentralen Telematikinfrastruktur (z. B. Konnektoren und Kartenlesegeräte) die sogenannte Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Von dieser Möglichkeit, die Datenschutz-Folgenabschätzung vom Gesetzgeber durchzuführen, wird erstmalig in Deutschland Gebrauch gemacht.
Die Praxen müssen den Datenschutz innerhalb der Praxis bis zum Übergabepunkt an die TI (Konnektor) sicherstellen. Ab dem Konnektor (beziehungsweise ab dem Konnektor-Ersatz in der TI 2.0), ist die gematik verantwortlich.
Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht – nicht in der digitalen und auch nicht in der analogen Welt.
Die gematik ist dafür verantwortlich, dass die Sicherheit in der TI nach Vorgaben des BSI und der DSGVO gewährleistet ist.
Nein. Aus der TI sind keine Rückschlüsse auf die interne Netzwerkkommunikation möglich.
Ja. Die gematik hat ein Rechtsgutachten zur Verfügung gestellt.
Hinweis der gematik zum Rechtsgutachten und der FAQ
Die Bereitstellung des FAQ-Katalogs kann im Einzelfall natürlich keine Rechtsberatung ersetzen. Dies sollte bei der Weiterverwendung des Katalogs beachtet und entsprechend kommuniziert werden. Bei den Antworten auf den FAQ-Katalog handelt es sich um einen Leitfaden für Leistungserbringer, der juristisch nachvollziehbar von dem Rechtsanwalt Herrn Dr. Ziegler hergeleitet wurde. Es kann jedoch im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden, dass eine richterliche Überprüfung zu einem anderen Ergebnis kommt.
Diese Klarstellung erscheint uns wichtig, da es bisher zu diesen Themen keine weiterführende Literatur oder gar richterliche Entscheidungen gibt. Trotzdem gehen wir aufgrund der fundierten juristischen Herleitung der Antworten im FAQ-Katalog davon aus, dass dieser eine gute Grundlage für den praktischen Umgang mit der elektronischen Patientenakte bietet.
Regelt die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte im § 291a SGB V und beauftragt die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens mit der Umsetzung.
Das „Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“ – das sogenannte E-Health-Gesetz – führte u.a. umfassende Änderungen im SGB V ein.
Die Entscheidungsprozesse in der gematik werden effektiver gestaltet, damit die Einführung weiterer Anwendungen der Telematikinfrastruktur und der elektronischen Gesundheitskarte zügig umgesetzt werden.
Digitale Helfer für die Pflege, mehr Telemedizin und eine moderne Vernetzung im Gesundheitswesen – das sind Ziele des Gesetzes zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG).
- All
- Elektronische Gesundheitskarte (eGK)
- Elektronischer Heilberufsausweis (eHBA)
- Praxisausweis (SMC-B)
- Signatur
Einige Funktionen innerhalb der Telematik-Infrastruktur können nur durch Authorisierung mit einer PIN genutzt werden. Dies gilt u.a. für den eMedikationsplans (eMP), eine optionale Sicherung des NFDM-Datensatzes oder die Nutzung der eRezept-App.
Für die elektronische Patientenakte (ePA) benötigen Sie die PIN nur, wenn Sie sich für die Login-Variante mit NFC-fähigem Smartphone, eGK und PIN entscheiden.
Voraussetzung für eine PIN-Vergabe ist eine eGK mit NFC-Funktion, die Sie bei Ihrer Krankenkasse anfordern können.
(Seit Ende 2020 statten alle Krankenkassen die elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit der NFC-Technologie aus. NFC steht für „Near Field Communication“ und bedeutet, dass der Datenaustausch auch kontaktlos erfolgen kann.)
Für die PIN-Vergabe müssen Sie sich als Kartenbesitzer eindeutig bei der Krankenkasse authentifizieren (per Video-Ident Verfahren oder durch persönliches Erscheinen in der Geschäftsstelle). Anschließend wird Ihnen die PIN per Post zugesendet.
Im oberen Teil der eGK finden Sie einen Streifen der die Farben der Deuschlandfahne hat.
Unter diesem Streifen ist eine 6 Stellige Nummer und ein NFC Zeichen hinterlegt.
Ja. Auf Wunsch des Patienten kann eine Vertreter-PIN durch die Krankenkasse auf der eGK eingerichtet werden.
Ein vom Patienten bestimmter Vertreter (kann auch der Hausarzt sein) kann so mit dessen eGK den elektronischen Medikationsplan zum Beispiel im Krankenhaus zur Nutzung freigeben.
Sollte der Patient eine neue eGK erhalten, muss die Vertreter-PIN neu eingerichtet werden, sofern sie weiterhin angewendet werden soll.
Die PIN-Eingabe wird nach jeweils drei Falscheingaben gesperrt und kann durch die PUK-Eingabe wieder aufgehoben werden. Die Karte kann beispielsweise über die E-Rezept-App der gematik entsperrt werden. Für die Auskunft zu anderen Möglichkeiten zur Entsperrung der Gesundheitskarte wenden sich Betroffene bitte an die Krankenkassen.
Die Sperrung erfolgt für jede PIN (Versicherter, Vertreter) einzeln. Bei gesperrter Vertreter-PIN kann der Versicherte weiterhin mit seiner PIN Funktionen ausüben.
Ist die eGK durch dreimalige Falscheingabe der PIN gesperrt, kann die Entsperrung über die E-Rezept-App sofort erfolgen.
Dafür ist die Kenntnis der PUK erforderlich, die Versicherte zusammen mit ihrer PIN von ihrer Krankenkasse erhalten.
Das Ändern der PIN ist dem Patient nur mittels technischer Lösungen durch die Krankenkasse möglich.
Für die vorgesehenen Daten im XML-Format reicht der Speicherplatz aus.
In weiterer Planung nach Gesetzeslage werden in den nächsten Jahren alle relevanten medizinischen Daten in der elektronischen Patientenakte gespeichert.
Der Abgleich der Patientendaten im Rahmen des Versichertenstammdatenmanagements (VSDM) ist immer ohne Eingabe der Patienten-PIN möglich.
Der direkte Zugriff auf die eGK kann nur mit einem eHBA erfolgen. Wenn die eGK vorliegt und alle Ärzte in der Praxis einen eHBA haben, ist dies möglich.
Beim Aufrufen des NFDM muss immer ein Auslesegrund angegeben werden:
- Anlage des NFDM
- Aktualisierung oder
- Notfall
Bei einem Notfall ist ein Zugriff immer möglich.
Nein. Der Patient benötigt nur seine eGK, wenn beispielsweise der Notfalldatensatz oder der eMedikationsplan auf die eGK geschrieben oder ergänzt werden sollen.
Ebenfalls wird die eGK (mit PIN) benötigt, wenn der Patient in der Praxis einen Zugriff auf seine ePA freigeben möchte.
Ein Rezept oder Medikationsplan kann ausgestellt werden. Hier ändert sich der Prozess in der Praxis nicht. Wenn keine eGK vorliegt, greift das Ersatzverfahren – der Patient muss seine eGK später nachreichen.
Für die Nutzung der ePA und des eRezepts wird eine NFC-fähige eGK benötigt. Diese muss bei der Krankenkasse beantragt werden.
Falls ein Patient, auf dessen eGK sich ein NFD oder eMP befindet, von seiner Krankenkasse eine neue Gesundheitskarte bekommt (z. B. bei einem Wechsel der Krankenkasse oder bei Kartenverlust), enthält die neue Karte grundsätzlich keinen NFD oder eMP, denn NFD oder eMP werden auf der jeweiligen eGK sowie in Kopie beim behandelnden Arzt / Krankenhaus gespeichert. In diesem Fall sollte der Arzt, der zuletzt Notfalldaten auf der eGK des Patienten gespeichert bzw. aktualisiert hatte, die Daten von seinem PVS / KIS beim nächsten Besuch des Patienten auf dessen neue Karte übertragen.
Da die Daten im PVS hinterlegt sind, können diese auf die neue eGK gespeichert werden. Mit entsprechender Dokumentation kann der Eintrag auch in der Abrechnung angegeben werden.
Damit sichergestellt ist, dass nur berechtigte Nutzer Zugang zur TI erhalten, benötigen alle Praxen und sonstigen medizinischen Einrichtungen einen elektronischen Praxis- beziehungsweise Institutionsausweis, in der IT-Sprache auch „Security Module Card Typ B“ (SMC-B-Karte) genannt.
Mittels dieser SMC-B-Karte registrieren sich die Praxen als Institution im Gesundheitswesen an der TI. Neben dem Konnektor und dem stationären Kartenlesegerät ist die SMC-B-Karte somit eine zwingend erforderliche Komponente für den TI-Zugang.
Ja. Dies gilt auch bei gemeinsamer Konnektornutzung in Praxisgemeinschaften.
Die SMC-B-Karte können Sie nur über die Online-Portale zugelassener Kartenhersteller beantragen. Eine Bestellung direkt bei der KV Nordrhein ist nicht möglich. Zugelassene Kartenhersteller sind
Funktional erhalten Sie bei allen Herstellern die gleiche SMC-B Karte, finanziell gibt es nur geringfügige Unterschiede. Der Hersteller unterscheiden sich bei Laufzeit und Zahlungsmodalitäten.
Gut zu wissen
- Aus Sicherheitsgründen müssen Sie sich per POSTIDENT-Verfahren bzw. per Online-Ausweisfunktion im Rahmen des Bestellprozesses legitimieren
- Die Lieferzeiten können herstellerabhängig vier bis sechs Wochen betragen.
- Die Zustellung erfolgt per Einschreiben immer (!) an die Praxisadresse. Bitte achten Sie darauf, dass ein Namensschild für die Zustellung unter dieser Adresse vorhanden ist, ansonsten wird die SMC-B Karte an den Aussteller zurückgeschickt.
Ja. Nach dem Patientendaten-Schutz-Gesetzes (PDSG) dürfen Ärzte und Psychotherapeuten die SMC-B-Karten nur bestellen, wenn sie einen eHBA besitzen.
Als Arzt, da sie dann mehr Möglichkeiten bei der Einsicht bzw. der Ergänzung der abgelegten Daten haben.
Die Bestellung von SMC-B-Karten erfolgt über die jeweiligen Anbieter. Die Überprüfung der Berechtigung findet bei der KV statt.
Nachdem der Antrag von Ihnen online ausgefüllt und eingereicht wurde, bedarf es einer Legitimation mittels POSTIDENT oder eines Online-Ausweises. Danach holt der Kartenhersteller bei der zuständigen KV die Bestätigung darüber ein, dass der Antragsteller tatsächlich Vertragsarzt bzw. -psychotherapeut oder ärztlicher Leiter eines MVZ ist und damit Anspruch auf eine SMC-B-Karte hat. So soll sichergestellt werden, dass nur berechtigte Nutzer Zugang zur TI erhalten.
Vor Freigabe der Bestellung muss die KV Nordrhein die Praxen anrufen und sich vom Praxisinhaber oder Praxispersonal die Bestellung bestätigen lassen. Dazu fragen die anrufenden KV-Mitarbeiter die Antragsnummer der Bestellung ab. Erst dann wird die Bestellung freigegeben. Darüber hinaus dürfen SMC-B Karten nur noch an eine Adresse geliefert werden, die bei der KV hinterlegt ist. Das ist in der Regel die Praxisadresse.
Anschließend erfolgen durch den Kartenhersteller Produktion und Versand. In der Regel wird Ihnen die SMC-B-Karte innerhalb von vier bis sechs Wochen vom Kartenanbieter mit der Post per Einschreiben zugestellt. Die dazugehörige/n PIN/s erhalten Sie zeitlich versetzt in einem separaten Umschlag mit normaler Briefpost.
Der Status der Bestellung kann im Antragsportal des Kartenherstellers eingesehen werden. Hierfür müssen Sie sich mit Vorgangsnummer und Passwort im Antragsportal einloggen.
Bei Fragen zu SMC-B-Karte oder PIN-Brief wenden Sie sich bitte an den Kartenhersteller, bei dem Sie die SMC-B-Karte bestellt haben.
Die KVNO verifiziert – nachdem das PostIdent Verfahren durchlaufen ist – den Antrag der Praxen (BSNR-Prüfung). Erst danach werden die SMC-B Karten durch den Provider produziert. Dieser Prozess dient der Sicherheit, es können sich so nur berechtigte Praxen an die Telematikinfrastruktur anschließen.
Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an das Team IT in der Praxis (it-in-der-praxis@kvno.de). Das Team kann auch einsehen, warum SMC-B Anträge abgelehnt wurden.
Es ist nur eine SMC-B-Karte für den Anschluss der Praxis an die Telematik-Infrastruktur notwendig. Diese wird in ein stationäres Kartenlesegerät gesteckt. Gibt es mehrere stationäre Kartenlesegeräte in einer Praxis, ist trotzdem nur eine SMC-B-Karte notwendig. Bitte beachten Sie, dass unabhängig von der Anzahl der stationären Kartenlesegeräte pro Betriebsstätte die Pauschale nur für eine SMC-B-Karte ausgezahlt wird.
Gut zu wissen
- Pro Betriebsstättennummer muss ein Antrag gestellt werden.
Es ist leider nicht möglich, mehrere Betriebsstättennummern in einem Kartenantrag anzugeben. - Nutzen Sie ein neues mobiles Kartenterminal, wird für dies ebenfalls eine SMC-B-Karte oder ein eHBA ab der Version G2 benötigt.
Sie dürfen nicht die SMC-B Karte des Vorgängers weiter nutzen. Bis Ihre eigene SMC-B Karte verfügbar ist, muss die TI deaktiviert und ein altes Kartenterminal zum Einlesen der eGK des Patienten verwendet werden. Die Praxis muss die TI im Rahmen des ersten Quartals der Niederlassung einrichten lassen, diese muss daher nicht zwingend zum Start vorliegen.
Sollte die Zustellung zum Beispiel aufgrund des Praxisurlaubes oder Abwesenheit nicht angenommen werden können, geht der Brief an die zuständige Postfiliale. Eine Nachricht über die Nichtzustellung sollte vom Briefträger hinterlassen werden.
Innerhalb einer Woche kann das Einschreiben in der Postfiliale abgeholt werden. Wird der Brief nicht innerhalb dieser Frist abgeholt, geht er zurück an den Kartenhersteller. Dieser versendet das Einschreiben umgehend erneut.
Nein. Der Kartenhersteller beginnt nach der Freigabe durch die KV unmittelbar mit der Produktion der beantragten SMC-B-Karten. Kulanzregelungen sind mit den einzelnen Herstellern zu klären.
Da die SMC-B-Karte einer Betriebsstättennummer zugeordnet ist, verbleibt sie in der Praxis, es ist hier keine Aktion notwendig.
Eine Sperrung/Kündigung der SMC-B-Karte kann aus folgenden Gründen notwendig werden:
- Der Praxisinhaber stellt seine Tätigkeit ein (BSNR wird beendet)
- Die SMC-B Karte wurde verloren oder gestohlen
- Die BSNR ändert sich
Die Praxis ist für die Sperrung/Kündigung der SMC-B Karte-verantwortlich. Bitte beachten sie die AGB zu Kündigungsfristen und dem Verbleib der SMC-B Karte.
Auch der Kartenhersteller und die KV sind berechtigt, SMC-B-Karten zu sperren.
Bitte wenden Sie sich zur weiteren Abklärung direkt an den Hersteller, bei dem Sie die Karte bestellt haben.
Für ermächtigte Einrichtungen, die nicht an ein Krankenhaus angebunden sind und mit den Krankenkassen direkt abrechnen, wurden Regelungen zur Erstattung der Kosten zum Anschluss an die TI in die Deutsche Krankehaus Gesellschaft (DKG)-TI-Vereinbarung aufgenommen. Demnach treffen die Vertragsparteien auf Landesebene dafür eine entsprechende Vereinbarung (vgl. § 3a Absatz 3).
Für den Anschluss an die TI benötigen diese Einrichtungen eine SMC-B. Hierfür ist eine Beantragung bei einem Anbieter für SMC-B-Karten sowie eine Freigabe des Antrages durch die KV auf dem üblichen Weg notwendig (vgl. § 3a Absatz 2).
Die Finanzierung der SMC-B-Karte läuft über die DKG.
Für Fragen zur TI-Finanzierungsvereinbarung steht Ihnen Gesine Schierenberg
(Tel.: 030 4005 1348, E-Mail: GSchierenberg@kbv.de) gern zur Verfügung.
Es gibt keine technische Notwendigkeit, Ermächtigte mit einer eigenen SMC-B Karte auszustatten, sofern diese über bestehende Krankenhausstrukturen an die TI angeschlosen sind. Allerdings liegt die Entscheidung, ob der Ermächtigte über die Anbindung des Krankenhauses an die TI angeschlossen werden kann, beim Krankenhaus.
Ein Krankenhaus kann bis zu 20 SMC-B-Karten mit einem Antrag bestellen, mindestens zwei SMC-B-Karten müssen bestellt werden, eine SMC-B-Karte dient hier als Ersatz.
Die SMC-B ORG als Institutionskarte für Organisationen wird an Organisationen im Gesundheitswesen ausgegeben, sofern diese zum Erhalt berechtigt sind. Dazu gehören u.a. Verbände, Dienstleister, Facheinrichtungen für Therapie und Pflege und Vereinigungen für Berufsgruppen.
Die SMC-B ORG ermöglicht es diesen Institutionen, die Telematikinfrastruktur als sicheres Netz für die Kommunikation via Kommunikation im Medizinwesen zu nutzen. Ein Zugriff auf medizinische Daten bzw. Anwendungen der Telematikinfrastruktur sind nicht möglich.
Herausgeberin der Institutionskarte für Organisationen ist die gematik.
Jeder Arzt oder Therapeut benötigt einen eHBA, der
- auf die medizinischen Anwendungen wie das NFDM, den eMP oder die ePA zugreifen möchte.
- eArztbriefe, eRezept oder die eAU signieren möchte.
MKG-Chirurgen können hier frei wählen, ob Sie Ihren Ausweis über die Ärzte- oder die Zahnärztekammer bestellen. Beide eHBA können gleichermaßen für die TI-Anwendungen verwendet werden. Nach Empfehlung der Ärztekammer sollten Sie die Auswahl dahingehend treffen, ob Sie mehr im zahnärztlichen oder im ärztlichen Umfeld tätig sind.
Ja. Der eHBA ist eine personenbezogene Karte und kann daher an jedem Leistungsort unabhängig vom Bundesland verwendet werden.
Für den Zugriff auf die ePA – ja. Gemäß § 339 Abs. 5 SGB V kann auch ein Arzt/ Psychotherapeut ohne eHBA/ ePtA durch einen anderen Arzt/ Psychotherapeut derselben Praxis mit eHBA/ ePtA für den ePA-Zugriff autorisiert werden.
Bitte beachten Sie aber: Wenn eRezepte oder eAUs signiert werden müssen oder Zugriff auf den eMP oder NFDM erforderlich ist, benötigt jeder Arzt in der Praxis seinen eigenen eHBA.
Ja. Im Rahmen der Vertretung nach § 32 Ärzte-ZV muss der Praxisinhaber den Vertreter vor Eintritt des Vertretungsfalls für den Zugriff auf die Patientenakten autorisieren und dieses auch entsprechend dokumentieren, wenn der Vertreter selbst nicht über einen eHBA verfügt.
Im Falle des Gnadenquartals muss der Vertreter einen eigenen eHBA besitzen, wenn kein anderer in der Praxis tätiger Arzt, eine Autorisierung und Dokumentation vornehmen kann.
Die Autorisierung und Dokumentation liegt in der Sphäre des Arztes. Dieser muss die Autorisierung und Dokumentation nach § 339 Abs. 5 SGB V nachprüfbar elektronisch protokollieren. Er muss also nachweisen können, durch wen im Einzelfall auf personenbezogene Daten zugegriffen wurde. Aus hiesiger Sicht dürfte er dieser Verpflichtung ausreichend nachkommen, wenn er die Protokollierung/Dokumentation bei sich vorhält und (nur) bei entsprechender Anforderung an die KV übermittelt.
Grundsätzlich scheint für dieses Szenario die Nutzung von sogenannten Remote-Kartenterminals in Verbindung mit der Komfortsignatur sinnvoll. Dies bedeutet, dass der eHBA in einem separaten Kartenterminal in einem zugriffsgeschützten Bereich der Praxis gesteckt ist. Alle notwendigen Arbeitsplätze in den Behandlungsräumen können dann auf diesen HBA zugreifen und entsprechend mit diesem HBA signieren –eine entsprechende Konfiguration der Systeme vorausgesetzt. Alternativ ist für das Szenario auch der zeitlich verzögerte Versand aller eAUs am Ende des Arbeitstages mittels Stapelsignatur denkbar.
Generell gilt, dass die genaue Ausgestaltung sich immer an den gelebten Prozessen der Arztpraxis orientieren muss und entsprechend stark variieren kann.
Das Antragsverfahren für den eHBA erfolgt ähnlich wie beim analogen Arzt- bzw. Psychotherapeutenausweis über die zuständige Landeskammer:
Nachdem Sie sich für einen Anbieter entschieden haben, gelangen Sie über dessen Website zu einem Antragsformular, das sie sorgfältig ausfüllen. Mit den Antragsunterlagen und Ihrem Ausweisdokument müssen Sie sich anschließend rechtssicher identifizieren – beispielsweise per Kammer- oder Post-Ident-Verfahren. Dann senden Sie Ihre Antragsunterlagen an Ihren Vertrauensdienstanbieter. Die eHBA-Karte und die PIN Briefe werden zeitversetzt und aus Sicherheitsgründen ausschließlich an Ihre Meldeadresse geschickt.
Generell ist es möglich, mehrere eHBAs zu bestellen. Ob das zweckmäßig ist, muss im Rahmen der jeweiligen Organisation entschieden werden.
Über folgende Anbieter kann ein eHBA bezogen werden. Er hat in der Regel eine Laufzeit von fünf Jahren.
Funktional sind die Ausweise gleich, die Anbieter unterscheiden sich vor allem in der Mindestlaufzeit und der Zahlweise. Auf fünf Jahre gerechnet unterscheiden sich die Kosten nur geringfügig.
Da mit einem neuen Personalausweis eine neue Personalausweisnummer vergeben wird, ist zunächst Beschaffung des neuen Personalausweises zu empfehlen, bevor der Antrag für den eHBA gestellt wird.
Hinweis: Für die Beantragung des eHBA kann statt des Personalausweises auch ein Reisepass in Verbindung mit einer Meldebescheinigung (nicht älter als 3 Monate) verwendet werden.
Mit ihrem eHBA erhalten Sie Zugriff auf medizinische Daten und Anwendungen der Telematikinfrastruktur (TI). Dieser Zugriff darf laut Gesetzgeber nur von Berechtigten erfolgen. Je nach Heilberuf (Arzt, Apotheker, Psychotherapeut) verfügen die Ausweise über unterschiedliche Zugriffsrechte.
Unter der Oberbegriff eHBA werden für einzelne Berufsgruppen manchmal auch folgende Bezeichnungen verwendet:
- Psychotherapeuten: ePTA
- Zahnärzte: eZAA
Im Vergleich der Heilberufsausweise verfügt der eHBA für Ärzte über die umfassendsten Zugriffsrechte.
Ja. Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der TI-Pauschale nur ein eHBA bezuschusst wird.
Haben Sie einen eHBA G0 und bestellen dann einen eHBA G2 wird der eHBA G0 für Sie kostenfrei und kann bis zum Ende der Laufzeit weitergenutzt werden. Hier entstehen dann keine doppelten Kosten.
Auf Ihrem eHBA werden Vor- und Nachname sowie gegebenenfalls der akademische Grad und außerdem ihre Berufsgruppe „Ärztin/Arzt“ gespeichert. Zusätzlich außerdem Ihre Telematik-ID und optional Ihre E-Mail-Adresse. Auf die Rückseite der Chipkarte wird Ihre einheitliche Fortbildungsnummer (eFN) aufgedruckt.
Der Anbieter sendet Ihnen den eHBA und eine sogenannte Transport-PIN an ihre Meldeadresse. Aus Sicherheitsgründen geschieht dies zeitlich versetzt in zwei Briefen.
Die Aktivierung des eHBA wird aus dem PVS heraus angesteuert und unterscheidet sich je nach Hersteller. Mit den Transport-PIN aktivieren Sie Ihren eHBA und setzen danach zwei individuelle PIN für die qualifizierte elektronische Signatur und die Verschlüsselung.
Mit dem eHBA können folgende Anwendungen genutzt werden:
- elektronische Signatur (QES)
- NFDM (07/2020)
- eMP (07/2020)
- ePA 1.0 (07/2021)
- eRezept (01/2022)
Über KIM:
- eArztbrief (07/2020)
- eAU (10/2021)
Die Ausgabe des eHBA der Generation „G2“ sollte nach Beantragung automatisch durch alle gematik-zugelassenen Anbieter erfolgen.
Frühere Generationen des eHBA (Generation G0 ist nicht für die TI geeignet) dürften die Anbieter nach unserer Kenntnis nicht mehr ausgeben.
Der „eArztausweis light2“ ist kein signaturfähiger Arztausweis, eignet sich nicht für die TI, kann aber direkt über die Ärztekammer ohne Kosten bezogen werden.
Der eHBA G0 verfügt über keine digitale Signaturfunktion. Optisch sind diese Ausweise ähnlich, ein Unterscheidungsmerkmal ist das Ablaufdatum. Auf der Vorderseite hat der G0 Monat.Jahr, der G2 Tag.Monat.Jahr aufgedruckt.
So können Sie den neuen eHBA G2/ G2.1 von der alten Version unterscheiden:
Der eHBA G2 und der eHBA G2.1 unterscheiden sich nur in einer Hinsicht. Für die Stapelsignatur wird beim eHBA G2 ein Konnektor mit Signaturanwendungskomponente (SAK) benötigt, bei der Version 2.1 ist ein Konnektor nicht notwendig.
Einziger Anbieter des eHBA der Generation 0 (eHBA G0) ist die Firma medisign GmbH. Wenn Sie bereits den eHBA G0 im Einsatz haben, können Sie nach Angaben des Anbieters medisign auch innerhalb der Mindestvertragslaufzeit ohne Zusatzkosten zur neuen Generation 2 wechseln. Technische Voraussetzung hierfür ist, dass Ihre Praxis den E-Health-Konnektor (PTV 3) im Einsatz hat. Der eHBA G2 wird mit der Gebühr gemäß medisign-Preisblatt berechnet. Der bisherige eHBA G0 wird kostenfrei gestellt, darf aber weiterhin für bewährte Anwendungen eingesetzt werden. Im Antragsprozess für den eHBA G2 wird abgefragt, ob Sie zuvor einen eHBA G0 genutzt haben.
Es Ihnen natürlich freigestellt, auch einen anderen von der gematik bestätigten Anbieter von eHBA G2 zu den jeweils anbieterspezifischen Vertragsbedingungen zu beauftragen.
Um den Missbrauch Ihres eHBA zu vermeiden, sollten Sie diesen möglichst umgehend sperren lassen. Hierfür stehen Ihnen bei den eHBA Anbietern verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Wir empfehlen die telefonische Sperrung, da hier zwischen Sperrwunsch und technischer Durchführung die geringste Verzögerung entsteht.
Wichtig! Die Sperrung des eHBA kann nicht rückgängig gemacht werden!
Um weiter mit einem eHBA arbeiten zu können, müssen Sie nach Sperrung eine Ersatzkarte beantragen, welche mit zusätzlichen Kosten für Sie verbunden ist.
Ja. Ab dem Zeitpunkt ab dem die Approbation vorliegt, kann ein eHBA bei der Ärztekammer bestellt werden, somit können auch Weiterbildungsassistenten einen eHBA nutzen.
Über die jeweils zuständige Apothekerkammer.
Anders als Vertragsärzte sind Klinikärzte nicht verpflichtet, einen eHBA zu besitzen.
Aber: Der Besitz eines eHBA ist aber für Klinikärzte zwingend notwendig, um auf die elektronische Patientenakte, das Notfalldatenmanagement oder den elektronischen Medikationsplan zugreifen zu können. Auch für das Ausstellen von eRezepten, eAU oder eArztbriefen benötigen Klinikärzte einen eHBA.
Ja, wenn eRezept und die eAU weiterhin unterschrieben werden müssen.
Da die meisten Notdienstpraxen aktuell noch nicht an die TI angebunden sind, wird hier derzeit noch das Ersatzverfahren verwendet. In diesem Fall wird keine Signatur mit dem eHBA benötigt.
Wenn Sie den Notdienst nicht selbst durchführen, muss das Ersatzverfahren verwendet werden. Sie dürfen nicht nachsignieren, wenn Sie den Patienten nicht persönlich gesehen haben.
Im Rahmen der TI-Finanzierung werden seit dem 01. Juli 2023 die Kosten des eHBA durch die monatliche TI-Pauschale anteilig finanziert.
Nein.
Die Pauschalen für den eHBA erhält das MVZ. Die Weitergabe der Vergütung ist im Innenverhältnis zu klären.
Nein. Nur der Arzt hat Anspruch auf die Pauschalen, da die Abrechnung des Weiterbildungsassistenten über den Arzt erfolgt. Vertreter haben ebenfalls keinen Anspruch auf die Pauschalen.
Das Gesetz sieht in § 278 SGB V vor, dass nur den an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringern die Ausstattungs- und Betriebskosten der Telematikinfrastruktur zu erstatten sind. Hierzu wurde die entsprechende TI-Finanzierungsvereinbarung geschlossen.
Diese Entscheidung obliegt dem Antragssteller. Wenn Sie vor der Namensänderung einen eHBA/ ePtA bestellen, fallen für einen späteren Kartenwechsel Kosten in Höhe von ca. 50 Euro an. Diese Kosten können jedoch je nach Kartenhersteller variieren.
Digitale Unterschriften („Signaturen“) werden für den eArztbrief, die eAU und das eRezept benötigt. Sie benötigen dafür den eHBA G2 bzw. G2.1.
Der eHBA G0 kann aktuell über KV-Connect nur für die Signatur von Arztbriefen, Laborbefunden und der Online-Abrechnung verwendet werden. Sobald diese Anwendungen in KIM migriert sind wird der eHBA G2 benötigt.
Einzelsignatur
Für jedes zu signierende Dokument muss der eHBA im Kartenterminal gesteckt sein und die qualifizierten elektronischen Signatur (QES) muss mit einer PIN bestätigt werden.
Stapelsignatur
Bei einer Stapelsignatur können mit der Eingabe einer PIN bis zu 250 Dokumente gleichzeitig signiert werden, also stapelweise. Diese Dokumente sind im Praxisverwaltungssystem in einer Ordnerstruktur hinterlegt und können für die QES ausgewählt werden.
Die Stapelsignatur kann für den eArztbrief und die eAU genutzt werden, weil diese gesammelt am Ende eines Tages signiert werden können.
Komfortsignatur (Rollout in die Praxen Q4/21 – Q1/22)
Die Komfortsignatur geht in puncto Benutzerfreundlichkeit über die Stapelsignatur hinaus und ist bei der Ausstellung von eRezepten in der Regel die organisatorisch sinnvollste Lösung, da hier die digitale Signatur direkt mit der Ausstellung des Rezeptes erfolgen muss.
Das Signieren von bis zu 250 Dokumenten kann nach einmaliger PIN-Eingabe über einen Zeitraum von maximal 24 Stunden erfolgen (die notwendige Konfiguration wird im Konnektor vorgenommen, die Funktion wird im PVS ausgeführt). Die Signatur wird dann bei Bedarf im Tagesbetrieb z. B. mittels persönlichem Passwort im PVS oder personalisierten NFC-Chip vom eHBA-Besitzer direkt über das PVS ausgelöst.
Voraussetzung dafür ist, dass der eHBA während der Nutzung der Komfortunterschrift dauerhaft im System vorhanden, d.h. in einem Kartenterminal gesteckt ist. Dazu muss das Kartenterminal in einem gesicherten Umfeld stehen.
Allgemeine Vorbereitung
- Der Konnektor ist für die Komfortunterschrift konfiguriert.
– max. 250 Unterschriften
– max. 24 Stunden Gültigkeit - Ein Kartenterminal steht in einem sicheren Umfeld (verschlossener Serverraum oder Serverschrank)
- Ein Kartenterminal in einem beliebigen Behandlungsraum
- Der Arzt hat im PVS eine eigene Benutzerkennung. Dadurch wird sichergestellt, dass nur er als Berechtigter eine Komfortunterschrift auslösen kann.
Tägliche Vorbereitung
- Der eHBA ist in einem Kartenterminal gesteckt, das Kartenterminal steht in einem sicheren Umfeld.
- Morgens wird die Komfortsignatur über das PVS aktiviert (über einen Kartenterminal am Arbeitsplatz) – eine einmalige PIN-Eingabe reicht.
Nutzung der Komfortunterschrift
- Nach Aktivierung kann die Komfortsignatur nun an beliebigen Terminals/Arbeitsplätzen innerhalb des Praxisnetzwerk genutzt werden. Die Signatur wird dann bei Bedarf im Tagesbetrieb z. B. mittels persönlichem Passwort oder personalisierten NFC-Chip vom eHBA-Besitzer direkt über das PVS ausgelöst.
Gut zu wissen
- Wenn die Komfortsignatur genutzt wird, muss der eHBA gesteckt bleiben. Wird der eHBA entfernt, verfallen eventuell noch im System vorgehaltene Komfortunterschriften.
- In ein Kartenterminal können Sie zwei eHBA stecken. Ob diese Funktionalität von Ihrem PVS-Anbieter unterstützt wird, erfragen Sie bitte bei seiner Hotline.
- Sind mehrere Ärzte in der Praxis tätig, werden die digitalen Signaturen über die Benutzerkennung dem Arzt zugeordnet.
Ja. Die im PVS hinterlegten und zu signierenden Dokumente (eArztbrief, eAU) können individuell ausgewählt werden.
Ja. Einzig die digitale Signatur ist Aufgabe des Arztes. Für Details in der Umsetzung in Ihrer Software wenden Sie sich bitte an den Anbieter.
Es ist davon auszugehen, dass rechtsverbindliche Unterschriften in den nächsten Jahren auch über sogenannte digitale Identitäten abgebildet werden können. Die Details sind noch nicht bekannt.
Nein. Die gematik arbeitet aktuell an einer Lösung.
Das Berufsfeld ist ein Freitextfeld, das individuell befüllt werden kann. Kontaktieren Sie Ihr PVS und lassen Sie sich beraten, wie Sie hier Korrekturen vornehmen können.
Seitens der KV gibt es an dieser Stelle keine Vorgaben.
Die Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) schreibt vor, dass die Person, die ein Arzneimittel verordnet, mit der Person übereinstimmen muss, die das Rezept unterschreibt. Geringfügige Abweichungen bei Umlauten, Groß-/Kleinschreibung, zweiter Vorname oder dem „ß“ zwischen der Bezeichnung auf dem eHBA und den Einträgen im PVS können hier zur Zurückweisungen bei der Einlösung eines Rezepts führen.
Wenn die Abweichung aber nur Sonderzeichen oder Schreibweisen oder einen zweiten Vornamen betrifft, jedoch klar ist, dass die verordnende Person auch die ist, die unterschreiben hat, kann die Apotheke in einer Übergangsphase das E-Rezept annehmen.
Hier reicht ein einfacher Internetanschluss (mindestens DSL, > 1 Mbit).
Eine Internetverbindung über LTE- oder UMTS Verbindung (Internet-Stick, Handy) ist prinzipiell möglich, bei Verfügbarkeit von DSL aber nicht empfehlenswert.
Sie erhalten auf keinem der beschriebenen Wege einen Internetanschluss? Weisen sie dies bitte mit einer Bestätigung eines Internetanbieters der KVNO nach.
Die KBV hat in einer Praxisinfo sehr transparent die Umsetzung sowie die Vor- und Nachteile der beiden Betriebsvarianten beschrieben:
Praxisinformation zu TI-Installationsvarianten in der Praxis (kbv.de)
Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb eines Internetanschlusses zählen zu den allgemeinen Praxiskosten einer Vertragsarzt- bzw. Vertragspsychotherapeutenpraxis.
Eine gesonderte Vergütung des Internetanschlusses sieht die Finanzierungsvereinbarung der TI nicht vor. Diese Vergütung ist auch kein Bestandteil der vereinbarten Pauschalen für die Erstausstattung und die Betriebskosten.
Nein. Weder der Konnektor noch der VPN-Zugangsdienst benötigen ein definiertes Betriebssystem in der Praxis. Sofern das PVS (auch heute schon) ein bestimmtes Betriebssystem voraussetzt, kann dieses weiterverwendet werden.
Die Komponenten müssen den Spezifikationen der gematik sowie den Sicherheitsvorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entsprechen.
Ihr Softwarehaus ist Ihr erster Ansprechpartner für die Bestellung aller Komponenten (Software, Konnektor, Kartenterminal) – bis auf die SMC-B-Karte und den eHBA G2.
Die technischen Komponenten werden durch die PVS-Hersteller bzw. deren Dienstleister oft in einem Bundle (Einsteiger-Paket) angeboten.
Die Bestellung des eHBA G2 erfolgt durch Sie persönlich über das Webportal der jeweiligen Kammer. Die Bestellung der SMC-B erfolgt über das Webportal des jeweiligen Kartenherstellers. Danach gibt die zuständige KV (als bestätigende Stelle) die vom Arzt gemachten Angaben bezüglich seiner Zulassung für die Bestellung der SMC-B frei.
Zugelassene Kartenhersteller sind
- die Bundesdruckerei,
- T-Systems und
- medisign
Das Prozedere der Bestellung und der Versendung sowie die Preisgestaltung der Karte obliegen dem jeweiligen Kartenhersteller.
Nutzen Sie als Praxisgründer- oder übernehmer in diesem Zusammenhang gerne das Beratungsangebot der KV Nordhein:
it-beratung@kvno.de.
Seit Verfügbarkeit der Telematik-Infrastruktur (TI) sind alle Anwendungen im sicheren Netz der KVen (SNK) direkt über die TI erreichbar. Dadurch kann bzw. soll der KV-SafeNet-Anschluss mit Installation der TI in jeder Arzt- und Psychotherapeutenpraxis entfallen.
Bitte testen Sie bei der TI-Installation mit dem Techniker vor Ort, ob dieser SNK-Zugang funktioniert. Erst wenn sichergestellt wurde, dass die KV-Anwendungen auch wirklich direkt über die TI erreichbar sind, kann der KV-SafeNet-Vertrag gekündigt werden.
Laut KV-SafeNet-Richtlinie V 3.2 kann der Vertrag zum Ende der Laufzeit des derzeit gültigen Zertifikates gekündigt werden. Sprechen Sie bezüglich der Kündigung Ihren zuständigen KV-SafeNet-Anbieter an.
Die Übernahme des Konnektors bei einem Inhaberwechsel der Praxis ist grundsätzlich möglich. Hierzu sind vier Schritte erforderlich:
- Es muss ein Übergabe-Vertrag für den Konnektor geschlossen werden, in dem bestätigt wird, dass der Konnektor im laufenden Praxisbetrieb weiter genutzt und an den Nachfolger übergeben wird.
- Der Pflege- und Wartungsvertrag muss auf den Nachfolger überschrieben werden.
- Es muss eine neue SMC-B-Karte bestellt werden, wenn sich die BSNR geändert hat. Die alte SMC-B-Karte kann nicht an den Nachfolger übergeben werden.
- Der Konnektor muss zurückgesetzt und neu installiert werden.
Sprechen Sie bitte vor der Übernahme frühzeitig mit Ihrem PVS-Anbieter. Für den Konnektor ist durch den Verkäufer (oder seinen IT-Dienstleister) eine De-Registrierung des Konnektors notwendig, wie durch die gematik gefordert. Der Käufer muss vor einer erneuten Inbetriebnahme die Unversehrtheit des Konnektors prüfen (Gehäuse-Siegel).
Vor einer solchen Entscheidung empfehlen wie Ihnen ein Gespräch mit der IT-Beratung. Kontaktieren Sie uns unter it-beratung@kvno.de.
Der Secure Internet Service (SIS) baut einen sicheren Tunnel (Virtual Private Network, VPN) zum Internet auf. Dieser arbeitet dabei als Firewall, die zusätzlich Viren entfernen und den Zugriff auf unsichere Webseiten blockieren kann. Das erhöht den Schutz der Praxissysteme. Der SIS wird in der Regel in Verbindung mit einer Reihenschaltung des Konnektors benötigt. Ob Sie mit den kostenfreien Tarifen ausreichend Volumen für Updates, Fernwartung und Nutzung des Internets haben, ist fraglich. Wenn Sie das Internet ohne Einschränkungen nutzen möchten, müssen Sie ein kostenpflichtiges Erweiterungspaket hinzubuchen. Sprechen Sie Ihr Softwarehaus an.
Bitte beachten Sie: Auch die Nutzung von SIS schützt nicht vor den Gefahren des Internets.
Der Zugang zur Telematik-Infrastruktur ist gänzlich unabhängig vom SIS.
Der Konnektor ist eine Art Router, ähnlich einem DSL-Router, allerdings auf einem deutlich höheren Sicherheitsniveau. Er ist mit den Kartenterminals und dem PVS verbunden und schafft den Zugang zur TI-Plattform. Der Konnektor stellt ein sogenanntes virtuelles privates Netzwerk (VPN) her, das es ermöglicht, elektronische Anwendungen unter Einsatz moderner Verschlüsselungstechnologien völlig abgeschirmt vom sonstigen Internet zu nutzen.
Daneben erfüllt der Konnektor noch andere Sicherheitsaufgaben, beispielsweise die Verschlüsselung und die qualifizierte elektronische Signatur.
Die PTV-Updates (ProduktTypeVersion) beschreiben die Funktionsfähigkeit des Konnektors.
Aktueller Rollout:
- PTV 1 ist der VSDM-Konnektor
- PTV 2 enthält die QES-Funktion (qualifizierte elektronische Signatur)
- PTV 3 ist der E-Health-Konnektor, mit dem die Anwendungen NFDM/eMP und KIM möglich sind
- PTV 4 wird für die Nutzung der ePA, der eAU und des eRezepts benötigt
- PTV 4 + ermöglicht die Nutzung der Komfortsignatur
- PTV 5 ist für die ePA 2.0 und den Einsatz der MIOs notwendig (verfügbar im Laufe Q1/2022)
Ja. Um mehrere Betriebsstätten an den Konnektor anbinden zu können, müssen Sie die TI-Zusatzpakete für Betriebsstätten bestellen. Ihr Systembetreuer kann Ihnen sagen, ob für Ihre Praxiskonstellation ein Konnektor ausreicht (beispielsweise eine Haupt- und mehrere Nebenbetriebsstätten oder auch eine Praxisgemeinschaft), oder ob pro Betriebsstätte jeweils ein Konnektor erforderlich ist.
Die Nutzung eines Konnektors, der im Rechenzentrum eines Anbieters gehostet wird, ist mit einer Auftragsdatenverarbeitung möglich.
Die IT-Sicherheitsrichtlinie legt fest, dass die TI-Komponenten in der Praxis entsprechend den Vorgaben im jeweiligen Handbuch vor dem Zugriff Unberechtigter geschützt werden müssen .
Nach 30 Tagen offline muss der Konnektor über die Administrationsoberfläche neu eingerichtet werden. Hierfür kann eine Technikerunterstützung hilfreich sein.
Der Konnektor ist für einen Dauerbetrieb ausgelegt.
Ja. Eine Fernwartung des PVS ist grundsätzlich weiterhin möglich, wenn der Konnektor parallel angebunden ist. Falls Sie die Reihenschaltung mit SIS verwenden, klären Sie diesen Punkt bitte mit Ihrem PVS-Anbieter.
Für Krankenhäuser werden spezielle Rechenzentrumskonnektoren empfohlen, an die man bis zu 50 Kartenterminals anschließen kann.
Das im Konnektor verbaute Sicherheitszertifikat (SMC-K) hat eine Laufzeit von maximal fünf Jahren und wird dann ungültig. Faktisch werden Konnektoren auf Grund der Lieferkette und Installationszeiten in der Regel nach 4 – 4,5 Jahren ersetzt.
Folgende Wahlmöglichkeiten haben Sie dann:
- Konnektortausch
- Laufzeitverlängerung (bis Ende 2025) der TI-Gerätekarte (SMC-K) – verfügbar ab Herbst 2023 für die Konnektoren von Secunet und Rise
- Anschluss über eine Rechenzentrumslösung (TIaaS)
Über das Ablaufdatum Ihres Konnektors können Sie sich als cgm-Kunde (Koco-Box Konnektor) hier informieren.
Das eHealth-Kartenterminal ist ein Kartenlesegerät. Das eHKT erkennt und liest die in der Telematikinfrastruktur eingesetzten Smartcards wie die elektronische Gesundheitskarte (eGK), Heilberufsausweis, Institutionskarte sowie Krankenversicherungskarten von privat Versicherten. Es dient somit der Identifikation von Versicherten, Leistungserbringern oder einer Einrichtung. Darüber hinaus gewährleistet das eHKT die sichere Eingabe von Versicherten- oder Leistungserbringer-PINs. Bitte beachten Sie, dass die Kartenterminals explizit für die Telematik-Infrastruktur zugelassen sein müssen.
Generell ist zu unterscheiden zwischen
- Stationären Kartenterminals (Anbieter: Cherry, Worldline) und
- mobilen Kartenterminals (Anbieter: div.)
Das stationäre eHealth-Kartenterminal verfügt über ein Display, ein PIN-Pad, mindestens einen ID-1-Kartenslot sowie mindestens zwei ID-000 Kartenslots.
„Alte“ stationäre Kartenterminals funktionieren nur zum Auslesen der Gesundheitskarten (eGK), wenn das PVS nicht an die Telematik-Infrastruktur angebunden ist. Sie können somit bei einem Ausfall des Konnektors als „Notfalllösung“ dienen.
Mobile eHealth-Kartenterminals benötigen für den Einsatz die Benutzung einer eigenen SMC-B Karte oder eines eHBA. Dies ist notwendig, um Daten von der eGK lesen zu können, die dort verschlüsselt abgelegt sind. Die eGK des Patienten wird in das mobile Kartenlesegerät eingelesen und die gespeicherten Daten werden später in das PVS übertragen. Auch mit den neuen mobilen Kartenlesegeräten wird kein Versichertenstammdatenabgleich möglich sein.
Jedes TI-fähige Kartenterminal kann für folgende Karten im Rahmen der Telematik-Infrastruktur genutzt werden:
- SMC-B-Karte (Praxisausweis)
Diese Karte in SIM-Größe ist für die technische Anbindung der Praxis an die Telematik-Infrastruktur notwendig. Sie wird einmal in der Praxis benötigt und in einem der vorhandenen Kartenterminals verbaut. - elektronische Gesundheitskarte (eGK)
Die eGK des Patienten kann in einem beliebigen vorhandenen Kartenterminal eingelesen werden (VSDM, NFDM, eMP). Für bestimmte Funktionen ist die PIN-Eingabe des Patienten notwendig. - elektronischer Heilberufeausweis (eHBA)
Der eHBA kann in einem beliebigen Kartenterminal eingelesen werden. Dies ist für den Zugriff auf die eGK und die digitale Signatur notwendig. Die für bestimmte Funktionen notwendige PIN kann über das gleiche Kartenterminal oder ein entferntes Kartenterminal (remote) eingegeben werden.
Bitte beachten Sie, dass laut Spezifikation der gematik ein Kartenterminal in der Lage ist, zwei eHBAs gleichzeitig zu verarbeiten. Dies macht im Rahmen der Komfortsignatur Sinn. Bitte sprechen Sie Ihren PVS-Hersteller an, ob diese Funktion durch das Programm unterstützt wird.
Seit Ende 2021 werden in den Praxen vermehrt Systemabstürze registriert, die in Korrelation mit dem Einlesen mancher elektronischer Gesundheitskarten (eGK) zu stehen scheinen. Konkret sind eGK’s vom Typ G 2.1 von dieser Problematik betroffen. Diese Karten sind mit der sogenannten NFC-Technologie (Near Field Communication) ausgestattet. Und genau diese Technologie steht im Verdacht im Zusammenspiel mit den betroffenen Kartenterminals, diese Systemabstürze zu bedingen. Zunächst wurde vermutet, dass trockene Winterluft und weitere äußere Faktoren wie Fußbodenbeläge und Plastikhüllen zu einer elektrostatischen Aufladung (ESD-Problematik) führen würden, die beim Stecken der eGK das System zum Absturz bringt. Seit dieser Erkenntnis versucht man, mit ESD-Matten, zusätzlichen Terminalaufsätzen und sonstigen Hilfsmitteln entgegenzusteuern. Die ESD-Problematik konnte man durch diese Maßnahmen weitestgehend in den Griff bekommen. Trotzdem konnte man anscheinend diese Systemabstürze der Kartenterminals nicht vollständig beseitigen. Aus diesem Grund geht man aktuell von weiteren möglichen Fehlerquellen aus. NFC-Karten können sich elektrostatisch oder innerhalb von Sekunden durch Funkwellen aufladen, sodass sie beim Einstecken einen Entlade-Impuls auslösen. Weiterhin haben NFC-Karten einen höheren Strombedarf und können zu einem Spannungsabfall im Kartenleser führen, der dann einen Absturz auslöst. Falls Sie trotz erfolgreicher ESD-Gegensteuerung Probleme bei Ihren Kartenterminals bemerken, wenden Sie sich gerne an Ihren IT-Dienstleister, den Kartenterminalhersteller oder direkt an die gematik über das Kontaktformular.
Das hängt letztendlich von der Praxisgröße und -organisation ab.
Unser Tipp:
- Psychotherapeutenpraxis:
1 Kartenterminal, wenn der Psychotherapeut die eGK des Patienten selber einliest
2 Kartenterminals, falls es einen Patientenempfang gibt - Arztpraxis
mindestens 3 Kartenterminals (abhängig von der Zahl der Behandler und der Größe des Empfangs)
– Empfang
– sicherer Bereich für den eHBA (Komfortsignatur, 2 eHBA pro Terminal möglich)
– Behandlungszimmer
Sie haben Fragen zur Organisation? Sprechen Sie uns an: it-beratung@kvno.de.
Ja. Die stationären Kartenterminals im Krankenhaus und in der Arztpraxis sind identisch.
Die gSMC-KT dient in der Telematikinfrastruktur als gerätespezifische Sicherheitsmodulkarte des Kartenterminals. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und muss danach ausgetauscht werden. Der Austausch wird durch Ihren IT-Dienstleister durchgeführt. Ein neues Kartenterminal ist nicht notwendig.
- All
- eArztbrief
- Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
- Elektronische Patientenakte (ePA)
- Elektronischer Medikationsplan (eMP)
- Elektronisches Rezept (eRezept)
- Kommunikation im Medizinwesen (KIM)
- Notfalldatenmanagement (NFDM)
- TI-Messenger (TIM)
- Versichertenstammdatenmanagement (VSDM)
Eine Übertragung mittels anderer Dienste als KIM ist nach der Übergangsfrist unzulässig. Der Gesetzgeber hat mit der Festlegung auf KIM in § 291f SGB V klar definiert, welche Anforderungen und welches Sicherheitsniveau für den Übertragungsweg eines eArztbriefes umzusetzen sind.
Seit Ende der Übergangsfrist am 31. März 2021 werden nur noch eArztbriefe vergütet, die mittels KIM übertragen werden.
Ab dem 1. März 2024 wird KIM und ab dem 1. April wird der eArztbrief für alle Praxen verpflichtend.
Details zur Vergütung des eArztbriefes, entnehmen Sie bitte dem Punkt „Vergütung“.
Die Gründe der Limitierung bei Verhandlungen auf Bundesebene sind uns im Detail leider nicht bekannt.
Der gemeinsame Höchstwert für versendete und empfangene eArztbriefe je Arzt pro Quartal beträgt 23,40 Euro.
Ja. eArztbriefe können nur dann vergütet werden, wenn diese per qualifizierter elektronischer Signatur (QES) unterschrieben wurden. Für die elektronische Signatur des eArztbriefes wird also ein eHBA G2 benötigt.
Bei einer Untersuchung, die nicht im Auftrag erfolgt ist (Überweisung), muss die Einwilligung des Patienten für die Übermittlung eines Arztbriefes eingeholt werden, da die Weitergabe personenbezogener Daten immer einer Einwilligung bedarf.
Ein Versand durch die MFA ist nach der Signatur durch den Arzt (z. B. Stapelsignatur) möglich, sofern die Berechtigungen im PVS vorliegen und es sich um eine Praxis-KIM-Adresse handelt.
In der Grundpauschale der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ist die Vergütung für den eArztbrief enthalten. Zur Signatur wird der ePtA benötigt.
Ursprünglich sollten ab dem 01. Oktober 2021 die AU-Daten verpflichtend via TI über den Kommunikationsdienst KIM an die Krankenkassen übermittelt werden (gesetzliche Vorgabe aus dem TSVG (§ 295 Absatz 1 SGB V)). Eine Verpflichtung für die Praxen besteht seit dem 01.07.2022.
Seit dem 01.01.2023 ist der für den 01. Juli 2022 geplante digitale Abruf der AU-Daten der Krankenkassen durch die Arbeitgeber (gesetzliche Vorgabe aus dem Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III) umgesetzt.
Das eAU-Update sollte nach Rücksprache mit Ihrem PVS-Anbieter eingespielt werden, sobald alle technischen Voraussetzungen erfüllt und getestet sind. Hintergrund ist, dass nicht bei jedem PVS die Möglichkeit besteht, die eAU vorab zu testen oder das Update später wieder zurückzusetzen.
Folgende Voraussetzungen sollten vor dem Einspielen des eAU-Update erfüllt sein:
- eAU-Update liegt vor und ist vom Systemhaus freigegeben
- KIM-Adresse liegt vor ist eingerichtet und funktionsfähig
(Testen Sie KIM, indem Sie sich selbst eine Nachricht zusenden!) - eHBA liegt vor und ist freigeschaltet
- Stapel- und/ oder Komfortsignatur sind möglich und wurden vorab getestet (z. B. mit eArztbriefen)
Der Gesetzgeber schreibt die digitale Übermittlung der AU-Daten an die Krankenkassen verbindlich vor. Das bisher für die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit genutzte Muster 1 sollte zum 1. Januar 2022 abgeschafft werden.
Wenn die digitale Übermittlung der Daten wegen technischer Probleme vorübergehend nicht möglich ist, wird mithilfe des PVS ein Ausdruck (Stylesheet) erstellt, der zur Information der Krankenkasse genutzt werden kann (siehe hierzu „Was ist, wenn die digitale Übermittlung vorübergehend nicht möglich ist?“). Dieses Verfahren ist aber nicht für den Regelfall vorgesehen.
| Fehlt / Defekt | Ersatzweise |
|---|---|
| eHBA | Signierung mittels SMC-B |
| TI-Anschluss / Verbindung | Ersatzverfahren Stylesheets an Kasse und an AG / Versicherten Details s. n. Frage |
| KIM-Dienst | Ersatzverfahren Stylesheets an Kasse und an AG / Versicherten |
| Geeigneter Drucker | Aktuell keine Vorgaben |
Als Transportweg für die eAU wird im Gesetz (§ 295 Absatz 1 SGB V) die TI vorgegeben. Die Vertragspartner KBV, KZBV, GKV-SV und DKG haben sich auf KIM (Kommunikation im Medizinwesen) als Transportweg geeinigt.
Wenn die digitale Datenübermittlung an die Krankenkasse vorübergehend nicht möglich ist, werden die Daten vom PVS gespeichert und der Versand an die Krankenkasse erfolgt, sobald die Anbindung wieder besteht.
Wenn der Patient oder die Patientin noch in der Praxis ist, drucken Sie den Ausdruck für die Krankenkasse aus. Der Versand an die Krankenkasse erfolgt dann über die Versicherten. Hat der Patient oder die Patientin die Praxis bereits verlassen und der digitale Versand ist auch bis zum Ende des nachfolgenden Werktages nicht möglich, muss die Praxis die Papierbescheinigung an die Krankenkasse versenden.
Um dieses – für die Praxen aufwändigere – Ersatzverfahren zu vermeiden, empfehlen wir die Nutzung der Komfortsignatur, die Probleme beim digitalen Versand in der Regel sofort erkennen lässt.
Nein. Da auf der Versichertenkarte die Institutskennung (IK) und die Versicherungskennnummer (VKNR) hinterlegt ist, kann bei der Erstellung der eAU diese vom Praxisverwaltungsprogramm automatisch eindeutig der Krankenkasse zugeordnet werden.
Ja. Die Ausfertigung für die Krankenkasse wird digital per KIM versendet. Der Patient erhält nur noch die Ausfertigung für den Arbeitgeber und sich selbst.
Der Arbeitgeber erhält weiterhin die gleichen Informationen wie vorher. Der Inhalt der Formulare bleibt unverändert.
Der digitale Datensatz der eAU wird vor dem Versand mit der qualifizierten elektronischen Signatur (QES) des elektronischen Heilberufsausweises (eHBA G2) signiert.
Um nicht bei jedem Vorgang die PIN eingeben zu müssen, können Sie per Stapelsignatur signieren, d. h. es werden zum Beispiel abends alle eAUs gleichzeitig signiert und versandt. Alternativ können Sie die Komfortsignatur nutzen. Hierfür geben Sie einmal die PIN ein und haben dann bis zu 250 Signaturen (Gültigkeit max. 24 Stunden) ohne PIN-Eingabe freigeschaltet. Die Signatur wird dann bei Bedarf im Tagesbetrieb z. B. mittels persönlichem Passwort oder personalisierten NFC-Chip vom eHBA-Besitzer direkt über das PVS ausgelöst.
Wir empfehlen die Nutzung der Komfortsignatur, da die eAU-Daten in diesem Fall sofort versandt werden und mögliche technische Probleme direkt erkannt werden können. Hierdurch kann ein für die Praxis aufwändigeres Ersatzverfahren vermieden werden (siehe hierzu „Was ist, wenn die digitale Übermittlung vorübergehend nicht möglich ist?“).
Wenn der eHBA G2 wegen technischer oder sonstiger Probleme, die nicht in der Verantwortung des Arztes liegt, nicht genutzt werden kann, darf mit dem Praxisausweis (SMC-B) signiert werden.
Ja das ist möglich, aber um Störungen möglichst sofort zu erkennen, wird die Komfortsignatur empfohlen.
Die Inhalte des Formulars bleiben unverändert. Bei der Ausfertigung für die Krankenkasse ist lediglich ein Barcode hinzugekommen, der die Datenerfassung erleichtern soll.
Die Vorlagen orientieren sich an Muster 1.
Beispiele finden Sie in den Erläuterungen zur eAU unter dem Punkt „Musteransicht Stylesheets“.
Mithilfe des Barcodes wird den Krankenkassen die Verarbeitung von papierhaften Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, welche im Ersatzverfahren der eAU ausgestellt werden, erleichtert. Das Formular mit Barcode ist ab dem 01. Januar 2022 gültig.
Keine Information über Vertragsärzte, nach Auskunft des GKV-Spitzenverbandes wird der Abruf der Daten durch die Arbeitgeber registriert.
Der Praxisverantwortliche haftet im Rahmen der Prozesse innerhalb seiner Praxis. Für Fehler außerhalb seiner Praxis – also die nachgelagerten Prozesse in der TI – ist die Praxis nicht verantwortlich.
Im Praxisverwaltungssystem erscheint eine Fehlermeldung. Diese kann zeitverzögernd erscheinen.
Nachdem der Versand einer eAU an die Krankenkasse stattgefunden hat, erhält die Praxis im Gegenzug entweder eine Empfangsbestätigung oder eine entsprechende Fehlermeldung. Somit kann nachvollzogen werden, ob der eAU-Versand erfolgreich war oder nicht. Eine allgemeine Regelung zur Aufbewahrungsfrist dieser Empfangsbestätigungen existiert derzeit nicht. Wir empfehlen allerdings, diese für ca. ein Jahr aufzubewahren.
Die Praxen müssen die eAU nicht an die Arbeitgeber übermitteln. Der Patient muss wie heute auch den Arbeitgeber über seine Arbeitsunfähigkeit informieren. Ab Januar 2023 soll der Arbeitgeber dann die eAU-Daten direkt bei der Krankenkasse abrufen können.
Wie bisher auch können die MFA eArztbriefe und eAU vor- und nachbereiten. Die digitale Unterschrift kann nur durch den Arzt erfolgen.
Fast alle Ärzte sind auch Arbeitgeber und benötigen von ihren Mitarbeitern eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU). Als Arbeitgeber können Sie ab Januar 2023 die eAU-Daten über das vordefinierte Arbeitgeberverfahren bei der Krankenkasse abrufen.
Nein. Die aktuelle Umstellung betrifft lediglich das Muster 1 (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung).
Weitere Muster sollen folgen – eine konkrete Zeitplanung liegt noch nicht vor.
Eine Rückholung fehlerhafter eAUs ist vorgesehen. Es gibt eine Storno-Option, die über das PVS initiiert wird.
Für Details nutzen Sie hier bitte die Hilfe-Funktion ihrer Software.
Die Krankenkassen leiten heute schon Daten der AU an Arbeitgeber weiter (Arbeitgeberverfahren). Der Prozess wird lediglich digitalisiert. Der fachliche Inhalt zur AU bleibt unverändert.
Bei Nicht-GKV-Versicherten (z. B. bei Versicherten der sogenannten sonstigen Kostenträger oder Berufsgenossenschaften) zeigt Ihr PVS Ihnen an, dass die digitale Übermittlung der AU-Daten an die Krankenkasse nicht möglich ist. Für diese Patienten kommt bis auf Weiteres das Ersatzverfahren zum Einsatz, d. h. Sie drucken die Stylesheets für Krankenkasse, Arbeitgeber und Versicherte aus und geben diese dem Patienten mit.
Für die Umsetzung der eAU erhalten die Praxen keine Gelder bzw. Erstattungen über die Finanzierungsvereinbarung. Lediglich die Einrichtung und Betriebskosten für KIM werden finanziert.
Für die Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen von Hausbesuchen/ Notdienst können Sie vorab in der Praxis unbefüllte Ausdrucke (Stylesheets) aus dem PVS erstellen. Diese können dann beim Hausbesuch/ Notdienst händisch befüllt werden. Die Daten übertragen Sie später in der Praxis in das PVS und schicken sie digital an die Krankenkasse. Alternativ können Sie erst nach dem Hausbesuch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in der Praxis erstellen und die beiden Ausdrucke per Post an den Patienten versenden.
Bei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die bei Hausbesuchen ausgestellt werden, muss die Übermittlung der Daten an die Krankenkasse bis zum Ende des folgenden Werktages erfolgen. Wenn Sie also am Freitagabend bei einem Hausbesuch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen, haben Sie bis Montagabend Zeit für die digitale Übermittlung der Daten an die Krankenkasse.
Zukünftig sollen auch Notfallpraxen an die TI angebunden werden, so dass hier der Versand der eAU ebenfalls möglich wird. Bis dahin gilt das Ersatzverfahren.
Hinweis: Alle PVS benötigen eine eAU-Zulassung auf dieser Grundlage: Technische Anlage eAU | KBV
Die Pflichtfunktion unter dem Punkt 6-02, Unterpunkt 4 verlangt den Ausdruck der Stylesheets als unbefüllte Blankoformulare. Sollte diese Option in Ihrem PVS noch nicht möglich sein, kontaktieren Sie Ihren PVS-Anbieter. Eine Übersicht, ob Ihr PVS-Anbieter bereits für die eAU zertifiziert ist finden Sie hier.
Die Kostenpauschale 40130 regelt die postalische Versendung einer mittels Stylesheet erzeugten papiergebundenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkasse des Patienten gemäß § 4 Absatz 4.1.4 Anlage 2b BMV-Ä.
Die Kostenpauschale 40130 ist nur berechnungsfähig, wenn nach Ausstellung festgestellt wird, dass die Datenübermittlung an die Krankenkasse nicht möglich ist und diese nicht bis zum Ende des nachfolgenden Werktages nachgeholt werden kann.
Die Kostenpauschale 40131 regelt die postalische Versendung einer mittels Stylesheet erzeugten papiergebundenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an den Patienten gemäß § 4 Absatz 4.1.2 Anlage 2b BMV-Ä im Zusammenhang mit der Durchführung einer Besuchsleistung entsprechend der Gebührenordnungspositionen 01410, 01411, 01412, 01413, 01415 und 01418.
Die Kostenpauschale 40128 regelt die postalische Versendung einer mittels Stylesheet erzeugten papiergebundenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an den Patienten, die im Rahmen einer Videosprechstunde ausgestellt wurde.
Es obliegt dem Arzt, in welcher Form er die AU im Rahmen der Frist aufbewahrt.
Gemäß der Berufsordnung NRW kann er alles digital aufbewahren, er muss nur sicherstellen, dass die Dokumentation revisionssicher und 10 Jahre verfügbar ist.
Die mithilfe des PVS erzeugten Ausdrucke können wahlweise im Format A4 oder A5 erzeugt werden. Die Ausdrucke müssen gut lesbar sein. Welcher Drucker hierfür eingesetzt wird, entscheidet die Arztpraxis. In den meisten Fällen dürfte ein Laser- oder Tintenstrahldrucker die wirtschaftlichste Option sein. Das hier verwendete normale Druckerpapier muss von den Praxen selbst im freien Handel beschafft werden. Sicherheitspapier ist nicht notwendig.
Stylesheets können auch ohne TI-Anbindung ausgedruckt werden. Eine regelhafte Nutzung ohne Anbindung an die TI ist nicht vorgesehen.
Ja. Sie können dem Patienten im laufenden Betrieb die AU aushändigen und die Ausfertigung für die Kasse am Ende des Tages per Stapelsignatur signieren und per KIM versenden.
Der Druck über den Nadeldrucker ist weiterhin möglich (mindestens 300 dpi), aber ist evtl. nicht wirtschaftlich. Aufgrund der Druckdauer durch die QR-Codes und die Lautstärke empfehlen wir den Wechsel auf Tintenstrahl- oder Laserdrucker.
Ja, pro Ausfertigung wird ein Blatt Papier bedruckt.
In dieser Situation wird das Ersatzverfahren analog zu den Hausbesuchen angewandt. Wenn Ihre Praxis bereits an die TI angeschlossen ist, können Sie die Stylesheets vorab leer ausdrucken, vor Ort händisch ausfüllen, den Patienten- und Arbeitgeberdurchschlag mitgeben und später aus der Praxis digital an die Krankenkasse versenden (Option 1). Oder Sie erfassen die Daten vor Ort, senden diese Daten später aus der Praxis digital an die Krankenkasse und versenden den Patienten- und Arbeitgeberdurchschlag per Post (Option 2). Falls die Praxis noch nicht an die TI angebunden ist, verfahren Sie wie zuvor beschrieben und händigen dem Patienten zusätzlich den Durchschlag für die Krankenkasse aus.
Wenn kein eHBA gesteckt ist, wird ihr PVS während des Signiervorgangs in der Regel fragen, ob Sie alternativ mit der SMC-B Karte signieren möchten. Zur genauen Vorgehensweise erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemhaus. Bitte beachten Sie, dass die Signatur mit der SMC-B Karte als Ersatzverfahren gilt und nur im Ausnahmefall anzuwenden ist.
Handelt es sich bei der eAU-ausstellenden Person um einen Weiterbildungsassistenten, ist es ggf. erforderlich, den zur Weiterbildung befugten Vertragsarzt zu hinterlegen. Aus diesem Grund bietet die eAU die Möglichkeit neben der Person, welche die AU-Bescheinigung ausstellt, auch zusätzlich eine für die AU-Bescheinigung verantwortliche Person zu hinterlegen, unter deren Aufsicht und Anleitung der Weiterbildungsassistent tätig ist. eAUs sind immer von der ausstellenden Person mit eigenem eHBA qualifiziert elektronisch zu signieren, d.h. der Weiterbildungsassistent benötigt, sofern er eAUs ausstellen soll, einen eigenen eHBA.
Diese werden weiterhin auf herkömmliche Weise (Muster 37) ausgestellt, da in der ersten Phase lediglich das Muster 1 ersetzt wird.
Nein. Bei Nutzung der Komfortsignatur kann von jedem beliebigen Arbeitsplatz eine digitale Signatur genutzt werden um eine eAU auszustellen.
Ja. Dieses Verfahren bleibt so bestehen.
Ja, eine bestehende Internet- und TI-Verbindung sind zur Ausstellung einer eAU zwingend erforderlich. Sollte es kurzzeitig zu technischen Störungen kommen, kann man den eAU-Vorgang im Nachhinein abschließen. Falls die Lösung des technischen Problems nicht absehbar sein sollte, tritt das entsprechende Ersatzverfahren in Kraft (Ausdruck der Stylesheets).
Für den Fall einer technischen Störung/Ausfall Ihres PVS sollten Sie sich einen Satz eAU-Stylesheets als Blankokopiervorlage ausdrucken und abheften. eAUs können im Notfall auch handschriftlich ausgestellt (dreifache Ausfertigung) und dem Patienten mitgegeben werden. So sind Sie bei Ausfall Ihres PVS weiter in der Lage, eAUs auszustellen.
Falsche Krankenversicherung
Manchmal kommt es vor, dass ein Patient nicht mehr bei der Praxis bekannten Krankenkasse versichert ist, über die eine eAU ausgestellt wurde. Das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) ist leider nicht immer aktualisiert, sodass dieser Umstand nicht zwingend beim Einlesen der eGK auffällt.
Die KBV rät in diesem Fall:
„Erhält eine Krankenkasse Arbeitsunfähigkeitsdaten zu einem Versicherten, der aktuell nicht bei dieser Krankenkasse versichert ist, […] versendet sie eine Fehlermeldung an den Vertragsarzt. Wenn die (neue) Krankenkasse oder der Versicherte zusätzlich einen entsprechenden Bedarf melden, erfolgt nach Aktualisierung der Stammdaten des Versicherten ein erneuter Versand der Daten an die korrekte Krankenkasse.“
Also kann die Fehlermeldung ignoriert werden, bis sich die neue Krankenkasse oder der Patient bei der Praxis meldet.
Einzelne eAU können nicht versendet werden
Jede Krankenkasse hat eine oder mehrere Institutskennziffern (IK). Mitunter soll es bei der Konfiguration auf PVS-Seite oder beim Kassendienstleister dabei Probleme geben. Die eAU kann dann keinem „Empfängerpostfach“ zugeordnet werden. Bemerken Sie, dass der eAU-Versand bei einzelnen Krankenkassen oder Patienten nicht funktioniert, kontaktieren Sie Ihr PVS und sprechen diese Fehler gezielt an. Anhand der Fehlermeldung sollte Ihr PVS die Fehlerquelle eindeutig identifizieren können.
Die elektronische Patientenakte (ePA) ist das zentrale Element der vernetzten Gesundheitsversorgung und der Telematik-Infrastruktur. Die ePA soll als lebenslange Informationsquelle dienen, die jederzeit einen schnellen und sicheren Austausch der Daten für Leistungserbringer und Patient ermöglicht. Es gibt für jeden Versicherten nur eine ePA.
Wichtig zu wissen: Eine ePA wird nur auf Wunsch des Patienten durch seine Krankenkasse angelegt. Die Krankenkasse selbst hat keinen Einblick in die ePA, Zugriffsberechtigungen werden ausschließlich durch den Patienten erteilt.
Lesen und sehen Sie mehr: Die elektronische Patientenakte
Hinweis: Da die ePA in der Hoheit des Patienten liegt, kann der Arzt prinzipiell nicht von einer medizinisch vollständigen Akte ausgehen.
Auf Seiten der Praxis
- Verfügbarkeit eines eHBA (rechtliche Voraussetzung für den Zugriff auf die ePA) pro Praxis
Mehr zum Thema eHBA - Update des Konnektors (min. PTV4)
- Update des PVS mit den entsprechenden Modulen für die ePA
Auf Seiten des Patienten
- Existenz einer ePA (Beantragung über die Krankenkasse)
- Freischaltung der ePA für die Praxis
Es besteht die Möglichkeit zur Einstellung folgender Daten in die elektronische Patientenakte:
- medizinische Informationen über den Versicherten für eine einrichtungsübergreifende, fachübergreifende und sektorenübergreifende Nutzung, insbesondere
- Daten zu Befunden, Diagnosen, durchgeführten und geplanten Therapiemaßnahmen, Früherkennungsuntersuchungen, Behandlungsberichten und sonstige untersuchungs- und behandlungsbezogene medizinische Informationen
- Daten des elektronischen Medikationsplans
- Daten der elektronischen Notfalldaten
- Daten in elektronischen Briefen zwischen den an der Versorgung der Versicherten teilnehmenden Ärzten und Einrichtungen (elektronische Arztbriefe),
- Daten zum Nachweis der regelmäßigen Inanspruchnahme zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen (elektronisches Zahn-Bonusheft)
- Daten zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (elektronisches Untersuchungsheft für Kinder)
- Daten über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung (elektronischer Mutterpass) sowie Daten, die sich aus der Versorgung der Versicherten mit Hebammenhilfe ergeben
- Daten der Impfdokumentation (elektronische Impfdokumentation)
- Gesundheitsdaten, die durch den Versicherten zur Verfügung gestellt werden
- Sofern Versicherte ihre Krankenkassen dazu berechtigen, können durch diese Abrechnungsdaten eingestellt werden. Damit wird für Patienten nachvollziehbar, welche Beträge für eine Behandlung abgerechnet wurden. Die Daten werden – bedingt durch die quartalsweise Abrechnung – erst mit entsprechendem Zeitverzug eingestellt.
Laut Spezifikation der gematik können folgende Dateiformate in der elektronischen Patientenakte gespeichert werden:
- JPEG
- PNG
- TIFF
- text/plain
- text/rtf
- XML
- HL7-V3
- PKCS7-mime
- FHIR+XML
Da die elektronische Patientenakte (ePA) patientengeführt ist, legt der Versicherte individuell fest, wer Zugriff auf die ePA bekommt. Er kann dazu einer Praxis einen beliebigen Zeitraum Zugriffsrechte gewähren. Eine differenzierte Freigabe von Dokumente je Praxis ist mit der ePA 2.0 seit Anfang 2022 möglich. Dazu ist ein Update des PVS und des Konnektors (PTV5) notwendig.
Es gibt gesetzlich festgelegte Berufsgruppen, die potentiell auf die ePA zugreifen dürfen. Momentan kann der Versicherte eine Freigabe für (Zahn-)Arztpraxen, Apotheken sowie psychotherapeutische Praxen erteilen. Krankenkassen haben keinen Einblick auf die Daten in der ePA, sie dürfen nur Informationen in der ePA zur Verfügung stellen (bsp. Verordnungen aus den letzten Jahren).
Der Nutzerkreis wird allerdings kontinuierlich erweitert. Schon ab dem 1. Januar 2022 wird eine Vielzahl an Gruppen, wie beispielsweise Hebammen, Physiotherapeuten oder die Pflege, an die Telematik-Infrastruktur angebunden. Dann kann der Versicherte auch diesen Beteiligten den Zugriff auf seine ePA einräumen.
Wichtig: Der gesetzliche Rahmen sieht für Berufsunfähigkeitsversicherungen keine Lese- und Schreibrechte vor, sodass diese keinen Zugriff auf die ePA erhalten können. Nicht einmal wenn der Versicherte dies möchte.
Die Patientenakte in Ihrem PVS und die ePA sind voneinander vollkommen unabhängig.
Der Patient entscheidet – in Absprache mit seinem Arzt – welche Dokumente aus dem PVS in die ePA kopiert werden sollen. In gleicher Absprache kann der Arzt Dokumente aus der ePA des Patienten in seine PVS-Patientenakte übernehmen (kopieren). Sie werden damit Teil seiner eigenen Dokumentation. Diese Dokumente stehen dem Arzt auch dann noch zur Verfügung, wenn er keinen Zugriff mehr auf die ePA des Patienten hat.
Welche Dokumente im Zeitraum der Freigabe durch den Patienten in der ePA vorhanden sind (bzw. auf welche Dokumente die Praxis Zugriff oder keinen Zugriff hat) wird nicht festgehalten. Es handelt sich hier um einen dynamischen Prozess und ist vergleichbar mit Informationen in Papierform. Von daher kann es Sinn machen, das Kopieren von Dokumenten in die ePA in der PVS-Patientenakte zu dokumentieren.
Da der Patient alleine die Verfügungsgewalt über die Dokumente in seiner ePA hat, kann er diese auch jederzeit wieder löschen. Inhaltlich verändern kann er sie natürlich nicht.
- Start der ePA 1.0 zum 1. Januar 2021: Verfügbarkeit für Versicherte durch die Krankenkassen
- Start der ePA 2.0 zum 1. Januar 2022 mit medizinischen Informationsobjekten (MIOs) und differenziertem Rechtekonzept
- Start der ePA 3.0 zum 1. Januar 2023 mit freiwilliger Datenspende zu Forschungszwecken
Für alle Vertragsarzt-Praxen (also auch Pathologen oder Laborärzte) ist die Nutzung der ePA verpflichtend nach §341 SGB V – PDSG.
Ab dem 1. Juli 2021 müssen Vertragsarzt-Praxen die technischen Voraussetzungen für die ePA (Konnektor-Update, ePA-Modul und eHBA/ ePtA) erfüllen, ansonsten drohen Honorarkürzungen von einem Prozent.
Die technische Umsetzung innerhalb der Praxis-IT wird im Rahmen der Abrechnungsdatei der KV automatisch dokumentiert – ein Nachweis der Installation seitens der Praxis ist nicht notwendig.
Der Schutz der persönlichen Gesundheitsdaten hat höchste Priorität. Die gesetzlichen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit sind sehr hoch. Daher sind die Inhalte der medizinischen Dokumente Ende-zu-Ende verschlüsselt. So können die Dokumente nur von den Versicherten selbst oder von Personen, die sie ausdrücklich dazu berechtigt haben, gelesen werden.
Die Daten liegen sicher und verschlüsselt in den ePA-Aktensystemen des jeweiligen Krankenkasse. Die Krankenkassen haben keinen lesenden Zugriff auf die Inhalte der ePA. Sie können jedoch Daten wie z. B. Patientenquittungen oder Verordnungen in die ePA einstellen. Der sichere Zugriff auf die ePA wird über die Telematik-Infrastruktur ermöglicht. Die Server mit den ePA-Aktensystemen befinden sich in Deutschland und unterliegen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Unabhängige Gutachterinnen und Gutachter haben die sicherheitstechnische Eignung der ePA-Anbieter geprüft. Das war eine der Voraussetzungen, um die Zulassung von der gematik zu erhalten.
Medizinische Informationsobjekte (MIO) dienen dazu, medizinische Daten standardisiert, also nach einem festgelegten Format, zu dokumentieren. Sie können als kleine digitale Informationsbausteine verstanden werden, die universell verwendbar und kombinierbar sind.
Ziel ist es, dass MIO im Sinne der Interoperabilität für jedes System lesbar und bearbeitbar sind. Informationen sollen so deutlich leichter zwischen den einzelnen Akteuren im Gesundheitswesen ausgetauscht werden können.
Im Jahr 2020 hat die KBV planmäßig vier medizinische Informationsobjekte festgelegt:
- den Impfpass,
- das Zahnärztliche Bonusheft
- den Mutterpass und
- das Kinder-Untersuchungsheft.
Das Konzept der MIO stammt von der KBV. Sie folgt damit dem Auftrag aus dem TSVG, die semantische und syntaktische Interoperabilität für Inhalte der elektronischen Patientenakte in Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen und Organisationen zu erarbeiten und festzulegen.
Ja, im Rahmen der Anamnese sind Sie verpflichtet, nach der ePA zu fragen. Sollte eine ePA vorhanden sein, fragen Sie den Patienten, ob Sie auf die ePA zugreifen dürfen.
Es sind aber keine vertragsärztlichen Beratungspflichten des Versicherten zur Funktionalität oder Nutzung der ePA vorhanden. Die Information zur ePA ist, nach SGB V, Aufgabe der Krankenkassen. Wir gehen davon aus, dass die Krankenkassen zukünftig verstärkt ihre Mitglieder informieren werden.
Jeder gesetzlich Versicherte hat einen Anspruch auf eine elektronische Patientenakte, die bis zum 16. Geburtstag des Kindes von einem ebenfalls gesetzlich versicherten, sorgeberechtigten Vertreter verwaltet wird.
Nach dem Tod des Versicherten wird die ePA durch die Kasse spätestens nach zwölf Monaten gelöscht. Die Erben haben keinen Zugriff auf die Daten, können aber die vorzeitige Löschung der ePA nach dem Tod des Versicherten beantragen.
Im Moment erfolgt der Zugriff in der Regel über das Smartphone und die entsprechende ePA-App der jeweiligen Krankenkasse. In 2022 sollen die Krankenkassen auch eine PC-basierte Anwendung zur Verfügung stellen.
Erklärvideos finden Sie in unserer Mediathek.
Mit der ePA 2.0 ab 2022 hat der Patient die Möglichkeit, seine ePA bei einem Krankenkassenwechsel mit zu nehmen.
Im Zuge der geplanten Anbindung von privaten Krankenkassen an die Telematik-Infrastruktur werden zukünftig auch Privatpatienten eine ePA nutzen können.
Auch Krankenhausärzte können – nach einer Freigabe durch den Patienten – auf die Inhalte der ePA zugreifen.
Ein Erklärvideo finden Sie hier: gematik-Video
Ja. Gemäß §341 Absatz 6 gilt: „Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer haben gegenüber der jeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung oder Kassenzahnärztlichen Vereinigung nachzuweisen, dass sie über die für den Zugriff auf die elektronische Patientenakte erforderlichen Komponenten und Dienste verfügen.“ Dies gilt übergreifend für alle Vertragsärzte.
Vertragsärzte können die sektorenübergreifende Erstbefüllung einer elektronischen Patientenakte ab sofort und auch rückwirkend bis zum 1. Januar 2021 abrechnen.
Detailinformationen finden Sie auf der ePA-Seite der KBV.
Thema Mehrfachabrechnung bei der Erstbefüllung:
Zu einer Mehrfachbefüllung und damit verbundenen Mehrfachabrechnungen kann es kommen, wenn beispielsweise ein Patient bereits eingestellte Daten wieder gelöscht hat und dies für den Arzt oder Psychotherapeuten nicht ersichtlich war. In diesem Fall kann die Krankenkasse die Pauschale für die Erstbefüllung von der Kassenärztlichen Vereinigung zurückfordern. Der Arzt oder Psychotherapeut erhält in diesem Fall stattdessen die „Zusatzpauschale für die ePA-Unterstützungsleistung“, die für die ärztliche ePA-Tätigkeit außerhalb der Erstbefüllung im Behandlungsfall berechnungsfähig ist.
Thema Vergütung im Krankenhaus:
Das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) besagt, dass das Krankenhaus für jeden vollstationären und teilstationären Fall eine Vergütung für die Speicherung von Daten in der ePA erhält.
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft (DKG).
Ab 2023 haben Versicherte die Möglichkeit, die in der ePA abgelegten Daten im Rahmen einer Datenspende freiwillig der Forschung zur Verfügung zu stellen. Details sind noch nicht bekannt.
Sie können dort – immer nur mit Einwilligung Ihrer Patientin bzw. Ihres Patienten – Dokumente wie Befunde, Diagnosen, Behandlungsberichte oder Therapiedokumentationen speichern. Willigt eine Patientin bzw. ein Patient ein, dass Sie Dokumente in die ePA übermitteln, führt dies nicht zum Bruch der Schweigepflicht, da nur die Patientin bzw. der Patient diese Daten einsehen kann.
Nein. Die Behandlungsdokumentation wird nicht in der ePA gespeichert. Es werden ggf. Gutachten, Berichte und Arztbriefe in die ePA als Kopie abgelegt, wenn der Patient es wünscht.
Bei der versichertengeführten ePA hat der Patient die Datenhoheit über seine ePA. Er oder sein Vertreter können aus formaler Sicht alleine entscheiden.
Um einzelne Dokumente in der ePA schneller zuordnen zu können, werden diese automatisiert (durch das PVS) oder durch den Ersteller mit sogenannten Meta-Angaben gekennzeichnet (bspw. Befundbericht, Bilddaten, Laborergebnisse). Diese Meta-Angaben ermöglichen allen ePA-Nutzern eine schnellere Sortierung und Suche.
Wird im Hintergrund eine Logdatei geführt, die zeigt, wer wann auf welches Dokument zugegriffen hat?
Ja. Die Versicherten können ein Aktivitätsprotokoll einsehen, in dem jede Aktivität und Transaktion dokumentiert wird.
Ist dem Leistungserbringer bekannt, dass der Versicherte über keine ePA verfügt, insbesondere, weil der Versicherte die Frage nach der Existenz einer elektronischen Patientenakte verneint hat (siehe dazu Antwort auf voherige), besteht keine Pflicht des Leistungserbringers, ihn von sich aus auf die Möglichkeiten und die Bedeutung einer Anlage einer ePA für seine Versorgung hinzuweisen. Derartige Hinweise werden dem Versicherten über dessen Krankenkasse und das von dieser zu verantwortende Informationsmaterial erteilt.
Erkundigt sich der Versicherte hingegen beim Leistungserbringer danach, was eine elektronische Patientenakte sei und ob er eine solche einrichten solle, ist dieser auf eine solche Nachfrage verpflichtet, den Versicherten sachlich und neutral über die Funktion einer elektronischen Patientenakte zu unterrichten. Dabei genügt ein Hinweis darauf, dass eine elektronische Patientenakte, die mit bestimmten versorgungsrelevanten Daten befüllt ist, Anamnese und Befunderhebung von Leistungserbringern gezielt unterstützen kann. Für weitere Fragen sollte der Leistungserbringer auf die Krankenkasse des Versicherten und das dort vorgehaltene Informationsmaterial verweisen.
Es besteht keine Pflicht des Leistungserbringers, den Versicherten von sich aus auf etwaige Folgen einer bislang unterbliebenen Anlage einer ePA hinzuweisen. Fragt hingegen der Versicherte, ob er eine ePA anlegen solle, ist der Leistungserbringer verpflichtet, ihn sachlich zu unterrichten. Insbesondere hat der Leistungserbringer den Versicherten neutral über die Funktion der elektronischen Patientenakte zu informieren, Leistungserbringer als weitere Erkenntnisquelle bei Anamnese und Befunderhebung gezielt zu unterstützen.
Daher könne es sinnvoll sein, eine elektronische Patientenakte anzulegen. Letztlich liege es aber in der Verantwortung des Versicherten, ob er eine elektronische Patientenakte anlege und aktiviere. Wenn er, der Versicherte, Näheres wissen wolle, möge er sich an seine Krankenkasse wenden, welche ihm Informationsmaterial zur Verfügung stellen könne. Der Leistungserbringer sollte neutral und sachlich über die ePA informieren. Anderenfalls könnte Raum für das Argument geschaffen werden, er habe den Patienten sachlich unangemessen informiert und davon abgebracht, sich eine elektronische Patientenakte durch seine Krankenkasse zur Verfügung stellen zu lassen.
Auf Verlangen hat der Leistungserbringer den Versicherten bei der Befüllung der elektronischen Patientenakte zu unterstützen. Die Unterstützungsleistung bezieht sich auf eine Befüllung ausschließlich mit medizinischen Daten aus der konkreten aktuellen Behandlung, sie besteht ausschließlich im aktuellen Behandlungskontext. Deshalb erfasst der Anspruch des Versicherten auf Unterstützung bzw. auf Übertragung von Behandlungsdaten in die elektronische Patientenakte nicht jedes medizinische Datum, das im Rahmen der aktuellen Behandlung angefallen ist. Eine Überfrachtung der elektronischen Patientenakte mit Daten, deren Kenntnis für die weitere medizinische Behandlung des Versicherten nicht maßgebend ist, ist zu vermeiden. Gegenstand der Befüllung sind die diejenigen Behandlungsdaten, die für die aktuelle und / oder künftige medizinische Versorgung des Versicherten aus der Perspektive des aktuell behandelnden Leistungserbringers von Relevanz sein können. Deshalb hat ein Leistungserbringer eine Auswahl unter den im Rahmen der Behandlung angefallenen Daten zu treffen und dabei zu prüfen, welche Daten mit Blick auf die aktuelle oder künftige Versorgung des Versicherten von Bedeutung sein können.
Die ePA darf nicht mit Inhalten befüllt werden, die aus der Perspektive des um Unterstützung gebetenen Leistungserbringers nicht für die aktuelle oder künftige medizinische Versorgung des Versicherten relevant sein können. Auch besteht keine Pflicht zur Nacherfassung älterer bzw. früherer papiergebundener Daten, die nicht aus der konkreten, aktuellen Behandlung stammen.
Fällt im Rahmen der konkreten, aktuellen Behandlung eine Information aus der Behandlung an, das für die aktuelle und / oder zukünftige medizinische Versorgung des Versicherten von Relevanz sein kann, ist der Leistungserbringer verpflichtet, den Versicherten darüber zu unterrichten. Er hat den Versicherten insbesondere um die Erteilung einer Zugriffsberechtigung zwecks Befüllung der elektronischen Patientenakte mit den aus seiner Sicht versorgungsrelevanten Daten zu bitten. Lehnt der Versicherte die Erteilung einer Zugriffsberechtigung ab, muss der Leistungserbringer ihn darauf hinweisen, dass ein Unterbleiben einer Befüllung im Hinblick auf die aktuelle und / oder zukünftige Versorgung nachteilige Folgen haben kann, zum Beispiel Informationsdefizite bei nachfolgenden Behandlungsmaßnahmen. Die Erteilung eines solchen Hinweises sollte dokumentiert werden.
Der Versicherte hat gegen den Leistungserbringer einen Anspruch auf Unterstützung bei der Befüllung bzw. auf Übertragung von solchen aktuell angefallenen Informationen aus der Behandlung in die elektronische Patientenakte, welche für seine aktuelle und / oder künftige medizinische Versorgung relevant sein können. Der Leistungserbringer muss davon absehen, jedem Wunsch des Versicherten nach einer Befüllung der ePA nachzukommen, insbesondere nicht versorgungsrelevante Informationen aus der Behandlung in die ePA zu übertragen. Daher muss er Wünsche des Versicherten nach einer Befüllung der ePA daraufhin überprüfen, ob es um die Übertragung versorgungsrelevanter Informationen geht. Ist dies nicht der Fall, darf der Leistungserbringer den Wunsch nach einer Befüllung ablehnen. Insbesondere ist nicht vorgesehen, dass der gesamte Inhalt der Primärdokumentation in die ePA überführt wird.
Die elektronische Patientenakte ist versichertengeführt. Der Leistungserbringer ist nur berechtigt, die ePA insoweit mit Inhalten zu befüllen, wie die ihm erteilte Zugriffsberechtigung reicht. Daher hat er den Versicherten über die im Rahmen der aktuellen Behandlung angefallenen Daten zu unterrichten, welche für seine aktuelle und/oder zukünftige medizinische Versorgung des Versicherten relevant sein können. Dann obliegt es dem Versicherten, eine Zugriffsberechtigung für eine Befüllung der ePA zu erteilen. Ob er sich für das Einstellen sämtlicher versorgungsrelevanter Daten entscheidet oder nur einen Teil einstellen lässt, bleibt ihm überlassen. Allerdings sollte der Leistungserbringer den Versicherten, welcher sich für eine lediglich teilweise Befüllung der ePA entscheidet, darauf hinweisen, dass dies möglicherweise Folgen für seine aktuelle und / oder zukünftige medizinische Versorgung hat. Ein solcher Hinweis sollte dokumentiert werden. Mit der ePA ist allerdings kein Anspruch auf Vollständigkeit verbunden. Da sich ein nachfolgend tätig werdender Leistungserbringer ohnehin nicht auf die Vollständigkeit der Angaben in der elektronischen Patientenakte verlassen darf, darf sich der um eine lediglich teilweise Befüllung der ePA gebetene Leistungserbringer nicht darauf berufen, das Weglassen einzelner als versorgungsrelevant anzusehender Befunde befördere ein falsches Gesamtbild.
Der die ePA befüllende Leistungserbringer hat die Daten einer Kategorie zuzuordnen (z. B. Daten zu Befunden, Diagnosen, Therapiemaßnahmen; Daten des elektronischen Medikationsplanes; Daten der elektronischen Notfalldaten usw.). Des Weiteren muss er auf die Angaben in den Metadatenfeldern achten. Denn das Auslesen der elektronischen Patientenakte erfolgt in Gestalt einer Suche über die Angaben in den Metadatenfeldern. Dabei sind insbesondere folgende Metadatenattribute von besonderem Interesse: Name des Leistungserbringers, Fachrichtung des Leistungserbringers, Datum der Behandlung, auf der das Dokument beruht, Klassifikation des Dokuments (z. B. Befundbericht; Attest; OP-Bericht; Entlassbrief).
Es besteht keine Pflicht des Leistungserbringers, in seiner Primärdokumentation aufzuzeichnen, welche Daten er in die elektronische Patientenakte übertragen hat. Eine solche Dokumentation ist aber ratsam, da der Versicherte Inhalte der elektronischen Patientenakte löschen kann, ohne dass dies protokolliert wird. Dann kann im Nachhinein nicht nachvollzogen werden, ob und ggf. welche Daten durch den Leistungserbringer in die ePA eingestellt wurden.
Das Gesetz selbst enthält keine konkreten zeitlichen Vorgaben, wann die Befüllung stattzufinden hat. Allerdings knüpft die Befüllung an die Relevanz von Behandlungsdaten für die aktuelle und / oder die zukünftige medizinische Versorgung des Versicherten an. Daher wird die Befüllung umgehend zu erfolgen haben. Das kann zeitlich nachgelagert, nach dem Patientenkontakt sein, spätestens aber, sobald der Leistungserbringer die Relevanz für die weitere Versorgung des Patienten, ggf. nach Eintreffen weiterer andernorts erhobener Befunde anderer Leistungserbringer, einschätzen kann.
Die Auswahl der Daten, die für eine Befüllung überhaupt in Betracht kommen, setzt eine Bewertung der Relevanz für die aktuelle und / oder die zukünftige medizinische Versorgung des Versicherten voraus. Die Beurteilung der Versorgungsrelevanz darf nicht auf nicht-ärztliches Personal delegiert werden. Hingegen darf ein ärztlicher Leistungserbringer Hinweise auf mögliche versorgungsrelevante Folgen einer unterbliebenen Befüllung der ePA durch nichtärztliches Personal erteilen lassen.
Auch darf sich der ärztliche Leistungserbringer seines Personals bei der Übertragung der von ihm selbst ausgewählten Daten in die ePA bedienen. Dabei muss er solches Personal heranziehen, welches persönlich geeignet ist.
Es besteht eine Pflicht zur Dokumentation, welche konkrete Person auf die elektronische Patientenakte zwecks Befüllung zugriffen hat. Dies liegt daran, dass systemseitig etwaige Zugriffe nur bezogen auf die jeweilige Institution, z. B. Name der Arztpraxis, Abteilung des Krankenhauses, protokolliert werden.
Die elektronische Patientenakte ist versichertengeführt. Der Versicherte entscheidet nicht nur darüber, ob er eine elektronische Patientenakte hat, sondern auch darüber, ob und ggf. inwieweit er deren Inhalte aktualisiert bzw. aktualisieren lässt. Angesichts dieser „Patientensouveränität“ darf der Leistungserbringer die ePA nicht von sich aus aktualisieren. Eine Aktualisierung durch den Leistungserbringer setzt ein Verlangen des Versicherten voraus. Dieses Verlangen kann in der aktuellen Behandlungssituation geäußert werden. Auch kommt in Betracht, dass der Versicherte den Leistungserbringer durch eine einmal erteilte Zugriffsberechtigung für einen von ihm definierten Zeitraum zur Aktualisierung berechtigt. In beiden Fällen ist der Leistungserbringer zu einem Zugriff auf die ePA berechtigt, um Inhalte der ePA zu aktualisieren.
Der Versicherte hat gegenüber dem Leistungserbringer einen Anspruch auf Unterstützung bei der Aktualisierung der elektronischen Patientenakte, welcher sich auf die Übermittlung von medizinischen Daten ausschließlich aus der konkreten aktuellen Behandlung bezieht. Des Weiteren geht es um eine für die Versorgung des Versicherten erforderliche Aktualisierung von Inhalten. Deshalb darf der Leistungserbringer nicht jedem Wunsch des Versicherten nachkommen, sondern er muss prüfen, ob eine Übermittlung der im Rahmen der aktuellen Behandlung angefallenen Daten im Hinblick auf die aktuelle und / oder zukünftige medizinische Versorgung des Versicherten erforderlich ist.
Eine Aktualisierung muss für die aktuelle und / oder künftige medizinische Versorgung des Versicherten erforderlich sein. Eine Pflicht besteht insofern ausschließlich im aktuellen Behandlungskontext. Daher muss der Leistungserbringer Inhalte der ePA nicht auf Inkonsistenzen, Lücken oder Widersprüche zu anderen Informationsobjekten in der Telematikinfrastruktur prüfen und ggf. bereinigen. Eine Aktualisierung der Inhalte der elektronischen Patientenakte bedeutet vielmehr, dass er versorgungsrelevante Daten, die im Rahmen der aktuellen Behandlung angefallen sind, in die elektronische Patientenakte übermittelt, welche sich mit den darin bereits enthaltenen Inhalten auseinandersetzen. Soweit es in der ePA enthaltene Behandlungsdaten anderer Leistungserbringer anbelangt, führt dies dazu, dass der Leistungserbringer auf Verlangen des Versicherten die versorgungsrelevanten Daten der aktuellen Behandlung (z. B. einen Befundbericht) auf die bereits in der elektronischen Patientenakte befindlichen Daten „schichtet“.
Gesetzlich ist jeder Leistungserbringer nach einer von ihm vorgenommenen Änderung des Medikationsplanes verpflichtet, die geänderten Daten in der elektronischen Patientenakte zu speichern. Dies wird als Aktualisierung „im Sinne einer Synchronisation“ der ePA mit dem Medikationsplan auf der eGK bezeichnet. Dadurch sollen im Interesse der Patientensicherheit Inkonsistenzen zwischen dem Inhalt der elektronischen Patientenakte und dem elektronischen Medikationsplan auf der elektronischen Gesundheitskarte vermieden werden. Allerdings setzt eine entsprechende Aktualisierung der Inhalte der ePA ein Verlangen des Versicherten bzw. die Erteilung einer entsprechenden Zugriffsberechtigung voraus. Nach Erteilung einer solchen Berechtigung ist der Leistungserbringer zu einer Synchronisation der ePA mit dem Medikationsplan verpflichtet.
Eine Aktualisierung von Inhalten in der ePA und die damit zusammenhängende Unterstützungsleistung des Leistungserbringers bedeutet nicht, dass dieser jedwede (objektiv falsche) Information in der ePA korrigieren muss. Die Unterstützungsleistung knüpft daran an, dass im aktuellen Behandlungskontext Daten anfallen, welche eine Aktualisierung von Inhalten mit Blick auf die Versorgung des Versicherten erforderlich machen. Dementsprechend löst das Vorhandensein einer objektiv falschen Information in der ePA keine Pflicht zur Korrektur in der ePA vorhandener Einträge aus. Soweit der Leistungserbringer in der ePA vorhandene Informationen für unzutreffend hält und deshalb seine Behandlung auf andere Befunde stützt, braucht er die für falsch gehaltenen Informationen nicht zu korrigieren, sondern er sollte in seinem Befundbericht darauf eingehen, auf welche Befunde er seine therapeutische Entscheidung gestützt hat. Indem dieser Befundbericht dann in die ePA eingestellt wird, wird auf diese Weise für eine Aktualität der ePA gesorgt.
Anlass für eine Aktualisierung von Inhalten der ePA ist, dass im aktuellen Behandlungskontext Informationen angefallen sind, die mit Blick auf ihre Relevanz für die aktuelle und / oder künftige Versorgung des Versicherten eine Aktualisierung erforderlich erscheinen lassen. Ist eine solche Information aus der Behandlung angefallen, besteht bezüglich einer vom Leistungserbringer für erforderlich gehaltenen Aktualisierung die Pflicht, den eine Aktualisierung ablehnenden Versicherten darüber zu informieren, dass ein Unterbleiben einer Aktualisierung Folgen für dessen aktuelle und / oder zukünftige Versorgung hat. Ein solcher Hinweis sollte dokumentiert werden.
Die Auswahl der Daten, die für eine Aktualisierung überhaupt in Betracht kommen, setzt eine Bewertung der Relevanz für die aktuelle und / oder die zukünftige medizinische Versorgung des Versicherten voraus. Die Beurteilung der Versorgungsrelevanz darf nicht auf nicht-ärztliches Personal delegiert werden. Hingegen darf ein ärztlicher Leistungserbringer Hinweise auf mögliche versorgungsrelevante Folgen einer unterbliebenen Aktualisierung der ePA seitens nichtärztliches Personal erteilen lassen.
Auch darf sich der ärztliche Leistungserbringer seines Personals bei der Übertragung der von ihm zwecks Aktualisierung selbst ausgewählten Daten in die ePA bedienen. Dabei muss er solches Personal heranziehen, welches persönlich geeignet ist.
Die ePA ist versichertengeführt. Der Versicherte entscheidet darüber, ob er eine elektronische Patientenakte hat und folglich auch darüber, ob und ggf. inwieweit er Daten löscht oder löschen lässt. Angesichts dieser „Patientensouveränität“ darf der Leistungserbringer Inhalte der ePA nicht von sich aus löschen. Eine Löschung durch den Leistungserbringer setzt ein Verlangen des Versicherten voraus. Dann ist der Leistungserbringer zu einem Zugriff berechtigt, um die vom Versicherten ausgewählten Inhalte der ePA zu löschen.
Der Leistungserbringer muss dem Wunsch des Versicherten nachkommen. Vorher muss er ihn aber darauf hinweisen, dass ein Löschen im Hinblick auf die aktuelle und / oder zukünftige Versorgung nachteilige Folgen haben kann. Ein solcher Hinweis sollte dokumentiert werden.
Die ePA ist versichertengeführt. Der Versicherte entscheidet nicht nur allein darüber, ob er eine elektronische Patientenakte hat, sondern auch ob und ggf. inwieweit er Daten daraus löscht bzw. löschen lässt. Angesichts dieser „Patientensouveränität“ muss der Leistungserbringer Daten aus der ePA auf Verlangen des Versicherten löschen. Deshalb kann die Löschung der Daten an berufliche Gehilfen (nicht ärztliches Personal) delegiert werden. Dabei muss der Leistungserbringer solches Personal heranziehen, welches persönlich geeignet ist.
Auch darf die Aufklärung des Versicherten über mögliche nachteilige Folgen für die aktuelle und/oder zukünftige medizinische Versorgung delegiert werden.
Wenn der Versicherte dem Leistungserbringer eine Einsicht in die ePA verweigert, muss der Leistungserbringer dies akzeptieren. Der Leistungserbringer sollte den Versicherten auf die möglichen negativen Folgen und Nachteile für die zukünftige Versorgung und der unsicheren Informationsgrundlage für die Anamnese, einer möglichen Therapieentscheidung und die weitere Befunderhebung hinweisen. Der Wunsch auf Einsichtnahme durch den Leistungserbringer, die Weigerung des Versicherten in die Einsichtnahme und die möglichen Folgen der Weigerung sollten dokumentiert werden.
Die ePA ist versichertengeführt und deshalb muss der Leistungserbringer beim Versicherten nachfragen, in welchem Umfang er auf die ePA zugreifen darf. Falls eine zeitliche und / oder gegenständliche Begrenzung des Zugriffs durch den Versicherten gewünscht ist, muss der Leistungserbringer den Versicherten darauf hinweisen, dass dies Auswirkungen auf die aktuelle und / oder zukünftige medizinische Versorgung haben kann. Beispielhaft kann auf etwaige nachteilige Konsequenzen wie Doppeluntersuchungen, eine erschwerte Anamneseerhebung und mögliche Fehler bei Therapieentscheidung sowie weiterer Befunderhebung hingewiesen werden. Diese Aufklärung sollte auch dokumentiert werden.
Ob der Leistungserbringer in die ePA Einsicht nehmen muss, ergibt sich aus dem aktuellen Behandlungskontext unter Berücksichtigung des Facharztstandards. Erfordert die aktuelle Behandlung aus der ex-ante-Sicht des Leistungserbringers eine Befunderhebung, muss er die ePA als mögliche weitere Erkenntnisquelle in Betracht ziehen. Berichtet der Versicherte zum Beispiel von weiteren stattgehabten Untersuchungen und Befundungen, ist eine Einsichtnahme erforderlich. Hingegen wird die Notwendigkeit einer Einsichtnahme bei offensichtlichen Bagatellerkrankungen (zum Beispiel Schnupfen) nach dem Facharztstandard zu verneinen sein.
Der Leistungserbringer muss sich Kenntnis von denjenigen Inhalten verschaffen, die im Rahmen des aktuellen Behandlungskontextes nach seiner eigenen ärztlichen Entscheidung (aus der ex-ante-Sicht) für die Anamneseerhebung, Therapieentscheidung und weitere Befunderhebung notwendig sind. Hierbei ist die Suchfunktion über die Metadaten zu nutzen, insbesondere der Klassifikation des Dokumentes (z. B. Befundbericht; Attest; Operationsbericht; Entlassbrief, etc.), Datum des Einstellens, Facharztrichtung und Name des Einstellenden. Eine Volltextsuche ist nicht geboten. Auch im Rahmen des Anamnesegespräches kann eine Erheblichkeit von Daten für den aktuellen Behand-lungskontext abgeklärt werden.
Solche Inhalte dürfen nicht von vornherein bei der Suche über die Metadaten außer Acht gelassen werden. Der Leistungserbringer darf aber bei der in einem zweiten Schritt vorzunehmenden Bewertung der erhaltenen Suchergebnisse diejenigen von Krankenkassen eingestellten Informationen unberücksichtigt lassen, die wie reine Abrechnungsdiagnosen/Kodierungen aus der (fach-)ärztlichen Sicht ex ante keine Bedeutung für den aktuellen Behandlungskontext haben.
Solche Inhalte dürfen nicht von vornherein bei der Suche über die Metadaten außer Acht gelassen werden. Der Leistungserbringer darf aber bei der in einem zweiten Schritt vorzunehmenden Bewertung der erhaltenen Suchergebnisse diejenigen von Versicherten eingestellten Informationen unberücksichtigt lassen, die aus der (fach-)ärztlichen Sicht ex ante keine Bedeutung für den aktuellen Behandlungskontext haben.
Die infolge der Suche über die Metadaten erhaltenen Ergebnisse sind vom Leistungserbringer unter Berücksichtigung des Facharztstandards ärztlich zu bewerten. So können einzelne Suchergebnisse ohne weiteres als irrelevant einzustufen sein. Es ist aber auch möglich, dass eine ärztliche Bewertung erst nach einer näheren Betrachtung des einzelnen Datensatzes abgegeben werden kann. Dann muss sich der Leistungserbringer den Datensatz anzeigen lassen, um ihn zu würdigen. Die angezeigten Daten / Datensätze sind im Rahmen des aktuellen Behandlungskontextes bei Anamneseerhebung, Therapieentscheidung und weiterer Befunderhebung unter Beachtung des Facharztstandards zu berücksichtigen.
Der Leistungserbringer sollte die Ergebnisse der Einsichtnahme dokumentieren, z. B. im Rahmen eines Arztbriefes oder Befundberichtes. Es ist ferner ratsam, dass der Leistungserbringer die von ihm für relevant erachteten Informationen herunterlädt und in seine Dokumentation im Praxisverwaltungssystem aufnimmt.
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Antwort (Ziffer 1) darf der primär zugriffsberechtigte Arzt bzw. Facharzt einen Zugriff auf den Weiterbildungsassistenten delegieren. Im Rahmen einer dem weiterbildungsbefugten Arzt bzw. Facharzt erteilten Zugriffsberechtigung darf der Weiterbildungsassistent auf Daten in der ePA durch Nutzung seines Heilberufsausweises oder über die SMC-B des Krankenhauses Zugriff nehmen. Dies betrifft insbesondere die Befüllung der ePA, das Auslesen der ePA und das Löschen von Inhalten der ePA.
Die KV Nordrhein hat auf dieser Seite im Rahmen der FAQ für die elektronische Patientenakte (ePA) zahlreiche FAQs aus einem für die gematik erstellten Rechtsgutachten übernommen. Folgende Aussage der gematik bitten wir zu beachten:
„Die Bereitstellung des FAQ-Katalogs kann im Einzelfall natürlich keine Rechtsberatung ersetzen. Dies sollte bei der Weiterverwendung des Katalogs beachtet und entsprechend kommuniziert werden. Bei den Antworten auf den FAQ-Katalog handelt es sich um einen Leitfaden für Leistungserbringer, der juristisch nachvollziehbar von dem Rechtsanwalt Herrn Dr. Ziegler hergeleitet wurde. Es kann jedoch im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden, dass eine richterliche Überprüfung zu einem anderen Ergebnis kommt.
Diese Klarstellung erscheint uns wichtig, da es bisher zu diesen Themen keine weiterführende Literatur oder gar richterliche Entscheidungen gibt. Trotzdem gehen wir aufgrund der fundierten juristischen Herleitung der Antworten im FAQ-Katalog davon aus, dass dieser eine gute Grundlage für den praktischen Umgang mit der elektronischen Patientenakte bietet.“
Der eMP enthält einen strukturierten Überblick darüber, welche Medikamente ein Versicherter aktuell einnimmt. Darüber hinaus enthält der eMP medikationsrelevante Informationen, die wichtig sind, um unerwünschte Wechselwirkungen zu vermeiden, bspw. zu Allergien.
Für das Anlegen des eMP muss der eHBA G2 in einem beliebigen Kartenlesegerät innerhalb des Praxisnetzwerkes gesteckt sein.
Nähere Informationen finden Sie unter https://youtu.be/aNDXhB4gDSY (KVNO-Video)
Für das Auslesen des eMP muss der eHBA G2 in einem beliebigen Kartenlesegerät innerhalb des Praxisnetzwerkes gesteckt sein.
Nähere Informationen finden Sie unter https://youtu.be/62i03Z2eVYE (KVNO-Video)
Gesetzlich Versicherte haben gegenüber Ärzten Anspruch auf den bundeseinheitlichen Medikationsplan (BMP) bzw. den eMP, wenn sie mindestens drei zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnete, systemisch wirkende Medikamente gleichzeitig einnehmen bzw. anwenden.
Die Anwendung muss dauerhaft vorgesehen sein, das heißt über einen Zeitraum von mindestens 28 Tagen. Gegenüber Zahnärzten besteht dieser Anspruch nicht. Darüber hinaus kann die Nutzung des eMP bei folgenden Versicherten sinnvoll sein :
- Schwangere
- Patienten mit seltenen Erkrankungen
- Patienten, bei denen eine fachübergreifende bzw. intersektorale Zusammenarbeit (Arzt-Facharzt-Apotheke-Krankenhaus-Zahnarzt-Psychotherapeut) angezeigt ist.
Bei dem eMP handelt es sich um eine TI-Anwendung, die für Versicherte freiwillig ist. Als Vertragsarzt müssen Sie nach aktueller Gesetzeslage den eMP (§ 31a Abs. 3 S. 1 SGB V i.V.m.
§ 29a BMV-Ä) in Ihrer Praxis anbieten, denn Haus- und Fachärzte müssen für anspruchsberechtigte Versicherte den eMP erstellen und aktualisieren, wenn diese dies wünschen.
Neu ist somit, dass mit dem eMP auch jeder weiterbehandelnde Arzt verpflichtet ist, den Medikationsplan zu aktualisieren und mittels der eGK zu speichern, sobald die Medikation durch den jeweiligen Arzt geändert wird oder er ausreichend Kenntnis über eine Änderung hat und der Versicherte eine Aktualisierung wünscht.
Es besteht derzeit keine gesetzliche Pflicht für nichtärztlichen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen zum Einsatz der TI-Anwendung eMP.
Der eMP wird mithilfe des PVS auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) auf Wunsch des Patienten hinterlegt.
Für die Speicherung werden die PIN des Patienten (diese kann auf Wunsch auch deaktiviert werden) und ein eHBA G2 für die digitale Signatur benötigt.
Es wird auch eine Kopie des eMP in der elektronischen Dokumentation des Arztes im PVS gespeichert.
Ab 2023 sollen die Daten des eMP von der eGK in die Patientenkurzakte überführt werden.
Für die Einwilligungserklärung bestehen keine Formvorgaben (und auch keine Vorlage der KVNO), sie kann sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen und sollte dokumentiert werden.
Darüber hinaus muss vor jedem erneuten Zugriff die Zustimmung des Patienten eingeholt werden.
Der Patient kann seine Einwilligung jederzeit gegenüber einem Arzt oder Apotheker widerrufen.
Der Datensatz des eMP ist dann von der Gesundheitskarte (eGK) zu löschen.
Solange der eMP auf der Gesundheitskarte (eGK) des Patienten gespeichert ist, ist dies nicht möglich.
Ab 2023 sollen die Daten der eMP von der eGK in die Patientenkurzakte überführt werden.
Der eMP kann zur Zeit nicht mit den aktuellen mobilen Kartenterminals ausgelesen werden.
Im Prinzip Ja – wenn Sie als Arzt aber die fehlende Information aus medizinischer Sicht nicht verantworten können, können Sie die Anlage eines eMP-Datensatzes auf der elektronischen Gesundheitskarte verweigern. Sie müssen den Patienten dann auf diesen Sachverhalt aufmerksam machen.
Doppelte Verschreibung von Medikamenten kann aktuell nur passieren, wenn der Patient dem Zugriff auf den elektronischen Medikationsplan nicht zustimmt. Wenn der Zugriff erteilt wird, können alle aktuellen Medikamente eingesehen werden, sofern der eMP von allen Mitbehandlern gepflegt worden ist.
Ja. Die Daten aus dem BMP können in den eMP übernommen werden.
Nein. Der NFDM und eMP können unabhängig voneinander angelegt werden.
Der Patient erhält eine initiale PIN von seiner Krankenkasse.
Eine formale Zuständigkeit ist gesetzlich nicht verankert.
Sie müssen dem Patienten Sinn und Zweck des eMP erläutern sowie ihn über seine Rechte diesbezüglich aufklären (Anspruch, Löschung von Daten). Eine generelle Aufklärung über die Telematikinfrastruktur ist Aufgabe der Krankenkasse.
Konkrete Anleitungen zum Anlegen des eMP erhalten Sie vom Anbieter Ihres Praxisverwaltungssystems. Viele haben Erklärvideos auf ihrer Homepage hinterlegt.
Der Gesetzgeber definiert in §358 Absatz 3 den Anspruch des Versicherten auf Erstellung und Aktualisierung von elektronischen Notfalldatensätzen und Medikationsplänen. Nur sofern ausgeschlossen werden kann, dass jemals ein Patientenkontakt in der Betriebsstätte (dem Labor) stattfindet, greift der Anspruch nicht. Dann besteht keine Möglichkeit zum NFDM oder eMP (aufgrund der fehlenden eGK) und entsprechend müssen die Module nicht vorgehalten werden.
Das Konnektor-Update PTV3 muss in jedem Fall eingespielt werden, da dies sicherheitsrelevant und für den funktionalen Betrieb der TI erforderlich. Auch für das Lesen des eMP und NFDM ist die Anschaffung der Module innerhalb des PVS nötig.
Eine Übersicht der Vergütung des eMP finden Sie unter „Finanzierung NFDM/eMP„.
Ab dem 1. Januar 2024 wird das eRezept verpflichtend (Praxisinfo der KBV) . Vertragsarzt-Praxen müssen die technischen Voraussetzungen für das eRezept (eRezept Modul) erfüllen, ansonsten drohen ab April 2024 Honorarkürzungen von einem Prozent.
Seit dem 1. Juli 2021 kann das eRezept als freiwillige Anwendung in der sogenannten Testphase genutzt werden.
Für den Patienten ist die Nutzung der eRezepts-App der gematik freiwillig. Das eRezept kann auch als Stylesheet ausgedruckt oder via eGK ausgestellt werden.
Hinweis zu BtM- und T-Rezept:
Die Umstellung vom Papierrezept auf das eRezept betrifft zunächst verschreibungspflichtige und apothekenpflichtige Arzneimittel. BtM- und T-Rezepte, Privatrezepte, Rezepte für Hilfs- und Verbandmittel sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Nein, es wird weiterhin das Ausstellen von Muster 16 im Ersatzverfahren möglich sein. Damit Ihnen keine Sanktionen drohen, ist es wichtig, dass Sie die technischen Voraussetzungen erfüllen. Sie benötigen das eRezept-Modul in Ihrem PVS und den Konnektor in der Mindestversion PTV-4+. Beide Informationen werden im Rahmen Ihrer Abrechnung automatisiert und digital an Ihre KV übermittelt.
Welche Rezepttypen bereits per E-Rezept funktionieren, können Sie dieser Liste entnehmen:
- Apothekenpflichtige Arzneimittel („Rosa Rezept“)
- Empfehlungen der Ärztin bzw. des Arztes („Grünes Rezept“)
- Nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel für Kinder unter 12 Jahren
- Privatrezept für GKV-Versicherte („Blaues Rezept“)
- Hinweis: „Wunscharzneimittel“ können von Apotheken gegen Aufzahlung abgegeben werden
Detaillierte Informationen finden Sie unter eRezept.
Aktuelle Entwicklungen / Hinweise finden Sie auch auf der eRezept-Seite der gematik.
Die Daten werden verschlüsselt auf Servern der Telematikinfrastruktur (TI) gespeichert, die in vertrauenswürdigen Rechenzentren in Deutschland stehen. Der Fachdienst eRezept wird im Auftrag der gematik betrieben.
Die gematik-App „E-Rezept“ ist als Download in den gängigen App-Stores verfügbar.
Der Patient benötigt für die Anmeldung an der eRezept-App eine NFC-fähige Gesundheitskarte (eGK) mit PIN. Alternativ bieten die meisten Krankenkassen inzwischen eine Anmeldung über die jeweilige Krankenkassen App an.
Weitere Informationen zur eRezept-App erhalten Sie hier.
Das eRezept wird im PVS erstellt, die Informationen werden aber aus der Verordnungssoftware gezogen.
Um eRezepte auszustellen, wird immer eine aktuelle Version einer Arzneimitteldatenbank benötigt, damit auch die aktuellen Pharmazentralnummern (PZN) bei verschreibungspflichtigen Medikamenten übernommen werden können. Eine fehlerhafte PZN kann zu Fehlern bei der Einlösung von eRezepten führen.
Seit dem 1. April 2023 sind Mehrfachverordnungen möglich.
eRezepte im Rahmen von Mehrfachverordnungen sind maximal 365 Tage lang gültig. Wird ein Rezept nicht mehr benötigt, können Leistungserbringer über ihre Softwaresysteme und Patienten mithilfe der eRezept-App die Verordnung wieder löschen. Muss etwa die Dosierung geändert werden, wird die vorherige Mehrfachverordnung gelöscht und das eRezept – auch ggf. wiederum als Mehrfachverordnung – neu ausgestellt.
Patienten stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung, um eRezepte in der Apotheke einzulösen:
eRezept-App: Der Patient erhält das Rezept direkt auf sein Smartphone, kann dieses an die Wunschapotheke (auch online Apotheken) senden und das benötige Medikament vorbestellen. In kürze ist auch die Familienfunktion in der App verfügbar, mit der Rezepte für Angehörige in einer App verwaltet werden können.
Papierausdruck: Statt des „rosa Zettels (Muster 16)“ erhält der Patient einen Papierausdruck mit Rezeptcode. Pro Rezept können bis zu drei Medikamente verordnet werden.
Elektronische Gesundheitskarte (eGK): In der Apotheke vor Ort kann das Rezept über die eGK des Patienten abgerufen werden, die eGK dient in diesem Fall als Schlüssel. Die Apotheke kann mit diesem Schlüssel das eRezept auf dem Rezeptserver abrufen.
Weitere Informationen zum eRezept finden Sie hier.
Das Erstellen eines eRezeptes ist unabhängig von der physikalischen Verfügbarkeit der eGK des Patienten. Sobald der Patient in Ihrem PVS hinterlegt ist, können eRezepte ausgestellt werden.
Wenn die Versichertenkarte (eGK) für das Quartal eingelesen ist, können eRezepte ohne eGK ausgestellt werden (keine Veränderung zur bisherigen Lösung).
Ja. Nach der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV § 2, Absatz 1, Nr. 10) sind elektronische Rezepte mit einer qualifizierten elektronischen Unterschrift zu versehen. Dabei ist zu beachten, dass je Verordnung eine eSignatur erforderlich ist. D.h., dass bei einem Rezept mit drei Medikamenten drei Signaturen benötigt werden.
Im Fall eines Token-Ausdrucks muss dieser nicht zusätzlich unterschrieben werden.
Ja. Die Komfortsignatur ist möglich und sinnvoll, da das eRezept zum Zeitpunkt der Ausstellung und Übergabe an den Patienten signiert werden muss.
Technische Voraussetzungen müssen durch ein PTV4+ Update des Konnektors und entsprechende Anpassungen im PVS geschaffen sein. Verfügbarkeit je nach Anbieter seit Q4/2021.
Nein. Zukünftig werden Verordnungs- und Dispensierdaten (hierunter versteht man die Daten des tatsächlich abgegebenen Arzneimittels) automatisch in die elektronische Patientenakte übernommen. Dann kann der Versicherte Ärzten oder/und Apothekern Zugriffsrechte auf diese Informationen einräumen.
Hier gelten die gleichen Regeln wie beim Papierrezept.
Muster 16
Eine Verordnung darf nur innerhalb von 28 Tage nach der Ausstellung beliefert werden.
Die Belieferungsfrist endet auch dann mit dem Ablauf ihres letzten Tages, wenn dieser auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag fällt.
Wenn ein eRezept mehrere Medikamente enthält, diese aber in der Apotheke teilweise nicht vorrätig sind, so kann die Apotheke auch einzelne Medikamente ausgeben. Der Patient kann dann in eine andere Apotheke gehen und die restlichen Medikamente dort einlösen.
100 Tage nach dem Einlösen wird das eRezept laut gematik automatisch gelöscht.
Wird ein eRezept nicht eingelöst, wird es zehn Tage nach Ablauf der Rezeptgültigkeit (Gültigkeit von Kassenrezepten: 28 Kalendertage nach Ausstellung) automatisch gelöscht.
Der Patient kann aus der App auch eine Versand-, bzw. Online-Apotheke auswählen. Für Papier-Ausdrucke bieten diese in ihren Apps z. B. Scan-Optionen an.
Rezepturen, auch Wirkstoffverordnungen, sind entweder strukturiert oder per Freitext elektronisch zu verordnen. Voraussetzung für die strukturierte Ausstellung von Rezepturverordnungen ist, dass die Verordnungssoftware diese Funktionalität auch für das Papierrezept anbietet. Gleiches gilt für die Wirkstoffverordnung. Zytostatikazubereitungen entsprechend §11 Apothekengesetz sind ebenso elektronisch zu verordnen. Die gematik ermöglicht zukünftig einen Weg für die Direktübermittlung an die Apotheke.
Ja. Alle Angaben, die bisher auf Muster 16 hinterlegt wurden, müssen auch beim eRezept hinterlegt werden.
Favoriten können vom Nutzer angelegt werden.
eRezept-Versand via KIM an Apotheke/Pflegeeinrichtung.
Derzeit sind in Nordrhein ca. 50 Pflegeeinrichtungen an die TI angeschlossen.
Weitere Informationen zum Thema Pflege und TI finden Sie hier.
Es können bis zu drei Medikamente (Rezeptcodes) in einem Sammelcode zusammengefasst werden. Ein eRezept enthält künftig die Verordnung, eine Fertigarzneimittel- bzw. Wirkstoffverordnung, eine Rezeptur oder eine per Freitextfeld beschriebene Verordnung, wenn das zu verschreibende Produkt nicht im Preis- und Produktverzeichnis hinterlegt ist.
Sowohl über die eRezept-App der gematik, über den Papierausdruck als auch mittels der eGK kann der Patient einzelne Verordnungen des eRezepts bei Apotheken anfragen. Also wenn ein eRezept mehrere Medikamente enthält, diese aber in der Apotheke teilweise nicht vorrätig sind, so kann die Apotheke auch einzelne Medikamente ausgeben. Der Patient kann dann in eine andere Apotheke gehen und die restlichen Medikamente dort einlösen.
Die Vorgehensweise hat sich zum Muster 16 nicht geändert. Das E-Rezept kann von dem Apotheker nicht geändert werden. Eine Änderung der Abgabe eines Arzneimittels bei Lieferengpässen hinsichtlich der Wirkstärke ist jedoch möglich (Abgabe von z. B. 2 x 0,5 mg statt 1 mg). Hierzu muss lediglich eine Dokumentation durch den Apotheker erfolgen.
Die Praxisangestellten können zunächst das eRezept vorbereiten.
Danach muss durch den Arzt die elektronische qualifizierte Signatur (eQS) erfolgen. Diese kann nur der Arzt mit dem eHBA G2 vornehmen.
Sofern der Patient einen Tokenausdruck des eRezepts wünscht, kann das eRezept nach der Signatur durch die Praxisangestellten ausgedruckt und dem Patienten mitgegeben werden.
Das eRezept wird bei einer Folgeverordnung oder bei der Videosprechstunde wie bekannt erstellt.
Der Patient kann das Rezept über die App oder das Stecken der eGK in der Apotheke einlösen.
Sofern der Patient die Gesundheitskarte bereits im Quartal vorgezeigt hat, kann die Folgeverordnung ohne ein erneutes Stecken ausgestellt werden.
Ja. Durch die Praxis erstellte eRezepte können vom Arzt oder dem Praxispersonal gelöscht werden, sofern diese noch nicht in einer Apotheke abgerufen worden sind. Es empfiehlt sich in diesem Fall jedoch, den Patienten zu kontaktieren und mit ihm das weitere Vorgehen, z. B. die Ausstellung eines neuen eRezepts, zu klären.
Sie können selbsterstellte eRezepte in Ihrer Praxis löschen, sofern diese noch nicht durch
eine Apotheke abgerufen wurden. Da der Patient das gelöschte eRezept nicht mehr einlösen
kann, auch wenn er beispielsweise bereits den zugehörigen Token-Ausdruck erhalten hat, ist
es sinnvoll den Patienten zu kontaktieren und mit ihm das weitere Vorgehen zu besprechen.
Ist das eRezept bereits in der Apotheke in Bearbeitung, kann diese das eRezept löschen oder
dieses für die Löschung durch die Arztpraxis wieder freigeben. Dies kann notwendig sein,
wenn ein Verordnungsfehler eine Neuausstellung erforderlich macht. Versucht eine
Arztpraxis ein eRezept im TI-Fachdienst zu löschen/stornieren, das bereits gelöscht wurde
oder in Bearbeitung durch eine Apotheke ist, kann dies gegebenenfalls anhand der
angezeigten Meldungen im PVS nachvollzogen werden.
Bei Fragen zur konkreten Vorgehensweise in Ihrem PVS wenden Sie sich bitte an Ihren PVS-Anbieter / IT-Servicepartner.
Auch Patienten können ein eRezept mit Hilfe der eRezept-App löschen, sofern die Apotheke
dieses noch nicht abgerufen hat.
Nein, der Patient hat die Wahl, ob er einen Ausdruck zum eRezept erhalten möchte.
Nein, der Ausdruck ist kein rechtsgültiges Dokument, auch nicht mit Unterschrift. Der Ausdruck ermöglicht dem Apotheker mittels des aufgedruckten QR-Codes nur den Zugriff auf das eRezept auf dem Fachdienst.
Über den Token wird das eRezept vom eRezept-Server der gematik „abgeholt“. Nach der Dispensierung wird eine durch den Fachdienst eRezept signierte Quittung ausgestellt, die die Apotheke für die Abrechnung mit der Krankenversicherung verwenden kann. Der Token kann dann nicht erneut ausgelesen werden.
Der Ausdruck des Papier-Token kann bei Bedarf auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Der spätere Ausdruck ändert nichts an der Gültigkeit des erstellten eRezepts.
Die eRezepte werden von der Arztpraxis verschlüsselt an einen zentralen Dienst übertragen, dort verschlüsselt, gespeichert und verarbeitet und wieder verschlüsselt von der Apotheke abgerufen. Damit sind die eRezepte vor unbefugtem Zugriff geschützt. Zudem können nur Personen ein eRezept abrufen, die im Besitz des Rezeptcodes (eRezept-Token) sind. Das können Versicherte selbst, ein Vertreter oder die Apotheke sein. Der verordnende Arzt kann ein eRezept in begründeten Fällen wieder löschen, wenn dieses noch nicht von der Apotheke abgerufen wurde.
Nein, das ist nicht erlaubt.
Laut § 31 Absatz 1 Satz 5 bis 7 des SGB V dürfen Verordnungen weder unmittelbar noch mittelbar von Arztpraxen an Apotheken zum Einlösen übermittelt werden. Diese Regelung betrifft sowohl Muster 16 als auch die elektronische Verordnung.
Ausnahme durch § 12a ApoG
Eine Ausnahme des Zuweisungsverbotes ergibt sich jedoch aus § 12a ApoG. Absprachen sind möglich, wenn das Heim von einer öffentlichen Apotheke zentral versorgt wird, ein Heimversorgungsvertrag geschlossen wurde und die einzelnen Bewohner ihr Einverständnis gegeben haben, von dieser Apotheke versorgt zu werden.
Sind die Vorgaben erfüllt, kann die Praxis das eRezept direkt an die das Heim zentral versorgende Apotheke schicken. Falls ein Heimbewohner jedoch keine Einwilligung erteilt, muss das Rezept dem Heim beziehungsweise dem Patienten zugestellt werden.
Das Ausstellen von manuellen Rezepten (Muster 16) ist für diese Fälle weiterhin möglich.
Zunächst können eRezepte wie auch heute im Rahmen der Vereinbarungen zwischen DAV und GKV geändert werden. Sind Fehler enthalten, die in der Apotheke nicht „geändert“ werden können, ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich. Muss eine Änderung durch den Arzt vorgenommen werden, löscht er das eRezept und erstellt ein neues, denn mit der Signatur wird immer das tatsächliche eRezept signiert, was die Integrität sicherstellt.
In diesen zwölf Fällen dürfen Apotheken E-Rezepte „heilen“:
- Abweichung von der Verordnung bzgl. der Darreichungsform bei Fertigarzneimitteln
- Korrektur / Ergänzung der Darreichungsform bei Rezepturen
- Korrektur / Ergänzung der Gebrauchsanweisung bei Rezepturen
- Korrektur / Ergänzung der Dosierungsanweisung
- Ergänzung eines fehlenden Hinweises auf einen Medikationsplan, der das verschriebene Arzneimittel umfasst, oder auf eine schriftliche Dosierungsanweisung
- Abweichung von der Verordnung bzgl. der Bezeichnung des Fertigarzneimittels
- Abweichung von der Verordnung bzgl. der Bezeichnung des Wirkstoffs bei einer Wirkstoffverordnung
- Abweichung von der Verordnung bzgl. der Stärke eines Fertigarzneimittels oder Wirkstoffs
- Abweichung von der Verordnung bzgl. der Zusammensetzung von Rezepturen nach Art und Menge
- Abweichung von der Verordnung bzgl. der abzugebenden Menge
- Abweichung von der Verordnung bzgl. der abzugebenden Rezepturmenge auf eine Reichdauer bis zu sieben Tagen bei Entlassverordnungen
- Freitextliche Dokumentation der Änderung, wenn keiner der anderen Schlüssel / Fälle vorliegt
Ja, das ist möglich. Benötigt wird der QR-Code, z. B. auf dem Ausdruck, die eRezept-App oder die eGK des Versicherten für den das eRezept ausgestellt worden ist.
Nein. Im Störfall greift das Ersatzverfahren (Muster 16).
Für den Ausdruck des QR-Codes des eRezepts wird kein Sicherheitspapier benötigt. Sie können normales weißes Papier im Format A4 oder A5 verwenden. Die Kosten für das benötigte normale Druckerpapier trägt die Praxis.
Sofern der Patient sich nicht dafür entscheidet, den Token nebst Dosierangabe mitzunehmen, so wird aus datenschutzrechtlichen Gründen empfohlen, dass nach erfolgter Einlösung eines eRezeptes die abgebende Apotheke den Papiertoken einbehält und vernichtet.
Die Nutzung eines Papierrezepts (als Token-Ausdruck) ist weiterhin möglich.
Eine Erstattung für neue Drucker gibt es leider nicht.
Die Anschaffung neuer Drucker ist nicht zwingend erforderlich. Die KBV empfiehlt insbesondere für das eRezept einen Drucker, der mindestens in einer Auflösung von 300 dpi drucken kann. Eine geringere Auflösung oder ein verschmiertes Druckbild kann zu Problemen führen (z. B. beim eRezept beim Scannen der Data-Matrix-Codes in der Apotheke). Die meisten gängigen Standard Drucker haben eine Auflösung von 600 dpi.
Nein. Derzeit gibt es keine Ausnahmeregelungen.
Nein – wer verordnet muss auch digital signieren.
Bei der Ausstellung von eRezepten sind folgende Vertretungskonstellationen zu unterscheiden:
- Kollegiale Vertretung (nach § 20 Musterberufsordnung): Die/der abwesende Arzt lässt sich von einem fachgleichen Kollegen/in in dessen Praxis vertreten. Die Abrechnung erfolgt über die LANR/BSNR des Vertretenden. Im Datensatz der elektronischen Verordnung erfolgt keine Kennzeichnung einer Vertretungskonstellation, es werden die Daten der ausstellenden Person und der vertretenden Praxis übermittelt.
- Persönliche Vertretung: Ein Vertreter oder eine Vertreterin wird in der Praxis des Vertretenen tätig, bspw. als dessen Sicherstellungsassistentin im Falle von Kindererziehungszeiten. Rechtsgrundlage wäre hier § 32 Abs. 2, Satz 2 Ärzte-Zulassungsverordnung. Die Abrechnung erfolgt über die LANR/BSNR des Vertretenen. Es muss eine Kennzeichnung des Vertreters im Datensatz erfolgen. Es werden die Daten der vertretenden ausstellenden Person sowie des vertretenen Arztes und dessen Praxis übermittelt.
Elektronische Verordnungen sind immer von der ausstellenden Person mit eigenem eHBA qualifiziert elektronisch zu signieren.
Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten sind berechtigt, eRezepte auszustellen, solange die ordnungsgemäße Überwachung und Anleitung durch eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt gewährleistet ist. Die Leistungen der Ärztinnen oder Ärzte in Weiterbildung werden der weiterbildenden Person zugerechnet und diese ist für die Leistungen verantwortlich.
Es ist entsprechend der Vorgabe der Technischen Anlage eRezept immer eine weiterbildende Person mit anzugeben, wenn eine Weiterbildungsassistenz eine Verordnung ausstellt. Ebenso sind die Praxisdaten der weiterbildenden Betriebsstätte zu übermitteln. Eine LANR muss immer für die weiterbildende Vertragsärztin oder den Vertragsarzt angegeben werden. Sofern die Weiterbildungsassistenz bereits eine LANR besitzt, sollte diese ebenfalls angegeben werden. Personen in Weiterbildung signieren elektronische Verordnungen ausschließlich mit ihrem eHBA qualifiziert elektronisch. Zur Erstellung einer qualifizierten elektronischen Signatur, etwa für das eRezept, ist auch von der Weiterbildungsassistenz ausschließlich der eigene, persönlich gebundene eHBA zu verwenden. Verordnende und signierende Person müssen identisch sein.
Ja, ab 2025 sollen DiGA auch über das eRezept verordnet werden können.
Die MFA kann vorbereiten und ausdrucken – die Signatur muss vom Arzt durchgeführt werden.
Ja. Weitere Informationen finden Sie hier: eRezept bei einem Arbeitsunfall.
Auch in Notdienstpraxen, die bereits an die Telematik angeschlossen sind und damit die technischen Voraussetzungen erfüllen, wird die Nutzung des eRezeptes verpflichtend.
Für die qualifizierte elektronische Signatur ist für die Notdienst verrichtende Ärztin bzw. den verrichtenden Arzt die Nutzung eines eHBA zwingende Voraussetzung. Die Signatur mittels SMC-B Karte der Notdienstpraxis wird dann nicht mehr möglich sein.
Der dem eHBA ähnlich sehende eArztausweis light kann hierfür nicht verwendet werden. Da der eHBA personenbezogen ist, müssen auch Vertreter und Vertreterinnen im Notdienst einen eHBA für den Notdienst bereithalten. Weitere Informationen rund um die Einführung der Telematik in den Notdienstpraxen finden Sie hier.
Privatrezepte sind von der Pflicht zur Einführung der eRezepte zum 01.01.2024 ausgenommen. In der aktuellen eRezept-Ausbaustufe gilt dies auch für IVOM-Rezepte. Daher sollen Augenärzte weiterhin Privatrezepte verwenden, die im Rahmen des Formularversands zur Verfügung gestellt werden.
Ermächtigte Ärzte werden momentan von der eRezept-Pflicht ausgenommen.
Dies kann sich jedoch 2025 ändern, sobald Krankenhäuser ebenso dazu verpflichtet werden.
Das Notfalldatenmanagement (NFDM) besteht aus dem Notfalldatensatz (NFD) und dem Datensatz persönliche Erklärung (DPE).
Der Notfalldatensatz (NFD) beinhaltet insbesondere Allergien/Unverträglichkeiten, Medikationen, Diagnosen, Kontaktdaten von behandelnden Ärzten, Benachrichtigungskontakte im Notfall und zusätzliche medizinische Informationen auf Wunsch des Patienten.
Der Datensatz persönliche Erklärung (DPE) enthält Hinweise auf den Aufbewahrungsort folgender Dokumente: Organspendeausweis, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
Ja. Seit Inkrafttreten des Patienten-Datenschutz-Gesetztes (PDSG) am 19. Oktober 2020 sind alle Vertragsarztpraxen dazu verpflichtet, die technischen Voraussetzungen für die Nutzung des NFDM in ihren Praxen zu schaffen, denn Versicherte haben mit dem PDSG Anspruch auf die Erstellung, Speicherung und Aktualisierung eines Notfalldatensatzes durch den Vertragsarzt.
Im Notfall gilt: Es besteht eine – unter angemessener Berücksichtigung der Dynamik einer Notfallsituation – ärztliche Befunderhebungspflicht. Es besteht aber keine kategorische Auslesepflicht für den NFD.
Es besteht derzeit keine gesetzliche Pflicht für nichtärztlichen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen zum Einsatz der TI-Anwendung NFDM.
Für das Anlegen des NFD muss der eHBA G2 in einem beliebigen Kartenlesegerät innerhalb des Praxisnetzwerkes gesteckt sein.
Nähere Informationen finden Sie unter https://youtu.be/SzHk3FFDdWw (KVNO-Video).
Für das Auslesen des NFD muss der eHBA G2 in einem beliebigen Kartenlesegerät innerhalb des Praxisnetzwerkes gesteckt sein.
Sobald der NFD ausgelesen wird muss einer der folgenden Auslesegründe angegeben werden:
- Notfall
- Daten aktualisieren
- Abruf ohne Notfallhintergrund
Diese Information wird auf der eGK des Patienten gespeichert.
Weitere Informationen finden Sie unter https://youtu.be/4wpiATvjwe0 (KVNO-Video)
Ein Notfalldatensatz (NFD) ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Erkrankungen, Allergien oder Unverträglichkeiten vorliegen, deren Kenntnis in Notfallsituationen eine wesentliche Information für Ärzte, Zahnärzte, Mitarbeiter medizinischer Institutionen und Rettungsdienste darstellt. Primäre Zielgruppe für die Anlage eines NFD sind damit:
- Patienten mit komplexer Krankengeschichte (zum Beispiel langjährig bestehende chronische Erkrankung) mit einer Vielzahl von Diagnosen, Medikamenten und weiteren medizinischen Informationen oder Besonderheiten
- Patienten mit wenigen/einzelnen Erkrankungen, die jedoch aufgrund krankheitsspezifischer Merkmale eine hohe Notfallrelevanz haben (zum Beispiel bekannte schwere anaphylaktische Reaktion)
- Patienten mit seltenen Erkrankungen
- Schwangere
- Zusätzlich kann ein NFD auch bei Patienten sinnvoll sein, die für den Notfall wichtige Hinweise und Kontaktdaten zur Benachrichtigung von Angehörigen und behandelnden Ärzten/Zahnärzten bei sich haben möchten.
Der NFD wird mithilfe des PVS auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) auf Wunsch des Patienten angelegt/aktualisiert und muss vom Arzt mit dessen eHBA G2 signiert, das heißt rechtsgültig elektronisch unterschrieben werden.
Der Patient kann diesen Datensatz auf Wunsch per PIN vor dem unbefugten Zugriff schützen.
Es wird auch eine Kopie des NFD in der elektronischen Dokumentation des Arztes im PVS gespeichert.
Im Notfall können die NFD-Daten auch ohne PIN-Eingabe ausgelesen werden.
Auslesegrund, Zugriffszeitpunkt und zugreifender Person werden auf der eGK protokolliert.
Ab 2023 sollen die Daten des NFDM von der eGK in die Patientenkurzakte überführt werden.
Die Daten werden auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) auf Wunsch des Patienten gespeichert. Eine Signatur mit dem eHBA G2 ist nicht vorgesehen.
Ein DPE kann auch dann angelegt werden, wenn kein NFD existiert. Patienten können den DPE mittels technischer Lösungen ihrer Krankenkasse auch selbst anlegen und ändern.
Ab 2023 sollen die Daten des DPE von der eGK in die Patientenkurzakte überführt werden.
Für die Einwilligungserklärung bestehen keine Formvorgaben (und auch keine Vorlage der KVNO), sie kann sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen und sollte dokumentiert werden.
Darüber hinaus muss vor jedem erneuten Zugriff die Zustimmung des Patienten eingeholt werden.
Der Patient kann seine Einwilligung jederzeit gegenüber einem Arzt oder Apotheker widerrufen.
Der komplette Datensatz des eMP/NFD ist dann von der Gesundheitskarte (eGK) zu löschen.
Im Moment noch nicht, das soll aber künftig möglich sein.
Sie müssen dem Patienten Sinn und Zweck des NFDM erläutern sowie ihn über seine Rechte diesbezüglich aufklären (Anspruch, Löschung von Daten). Eine generelle Aufklärung über die Telematik-Infrastruktur ist Aufgabe der Krankenkasse.
Eine formale Zuständigkeit ist gesetzlich nicht verankert.
Der Gesetzgeber definiert in §358 Absatz 3 den Anspruch des Versicherten auf Erstellung und Aktualisierung von elektronischen Notfalldatensätzen. Nur sofern ausgeschlossen werden kann, dass jemals ein Patientenkontakt in der Betriebsstätte (dem Labor) stattfindet, greift der Anspruch nicht. Dann besteht keine Möglichkeit zum NFDM (aufgrund der fehlenden eGK) und entsprechend müssen die Module nicht vorgehalten werden.
Das Konnektor-Update muss in jedem Fall eingespielt werden, da dies sicherheitsrelevant und für den funktionalen Betrieb der TI erforderlich.
Auch für das Lesen des NFDM ist die Anschaffung der Module nötig.
Eine Übersicht der Vergütung des NFDM finden Sie unter „Finanzierung NFDM/eMP“.
Zurzeit in dies nur in Deutschland möglich. Ein Auslesen des Notfalldatensatzes soll EU-weit in einer späteren Ausbaustufe möglich sein.
Beim Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) überprüft das Praxisverwaltungssystem in Echtzeit („online“), ob die auf der eGK gespeicherten Versichertenstammdaten aktuell sind bzw. ob überhaupt ein gültiges Versicherungsverhältnis besteht. Zu den Stammdaten gehören Daten des Versicherten wie Name, Geburtsdatum, Anschrift und Versichertenstatus sowie ergänzende Informationen, zum Beispiel zum Zuzahlungsstatus. Sie dienen als Nachweis, dass der Patient versichert ist, und als Grundlage für die Abrechnung der Leistungen.
Diese Online-Überprüfung ist bei jedem ersten Patientenkontakt im Quartal verpflichtend.
Grundsätzlich besteht für alle an der ambulanten Versorgung teilnehmenden Ärzte, Psychotherapeuten und Einrichtungen mit direktem Arzt-Patienten-Kontakt eine VSDM-Pflicht. Dies beinhaltet zugelassene bzw. ermächtigte Ärzte, Psychotherapeuten und Einrichtungen wie zum Beispiel MVZ.
Gibt es keinen Arzt-Patienten-Kontakt, beispielsweise bei Laboren und Pathologen, oder erfolgt der Arzt-Patienten-Kontakt nicht in den eigenen Praxisräumen, zum Beispiel bei ausschließlich reisenden Anästhesisten, ist das VSDM nicht möglich.
Im Falle einer Behandlung, in der ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt (etwa bei Laborüberweisung) nicht erfolgt, ergeben sich Ausnahmen aus Anlage 4a zum BMV-Ä, die die KBV und die Krankenkassen bezüglich der Regelungen zum VSDM angepasst haben. In diesem Falle muss der Arzt kein VSDM durchführen. Sofern eine solche Ausnahme gegeben ist, werden die Versichertenstammdaten auf der Grundlage der Patientendatei übernommen.
Anästhesisten suchen häufig Patienten in der Praxis eines anderen Arztes auf. In diesem Versorgungskontext verwendet ein Anästhesist ein mobiles Kartenterminal, mit dem kein Versichertenstammdatenabgleich vorgenommen werden kann.
Laborärzte und Anästhesisten werden dennoch für den Anschluss an die TI ausgestattet und erhalten die entsprechende Förderung, damit sie weitere geplante Anwendungen in der TI nutzen können.
Hinweis: Trotzdem müssen sich alle erwähnten Fachgruppen ab 1. Juli 2020 an die TI angeschlossen haben.
Auch in den Nebenbetriebsstätten oder Zweigpraxen sind die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um bei jedem ersten Arzt-Patienten-Kontakt den Versichertenstammdatenabgleich durchführen zu können.
Bitte beachten Sie, dass der VSDM-Nachweis in der Abrechnung nur berücksichtigt werden kann, wenn der Patient zu der eingelesenen eGK auch behandelt und die Behandlung entsprechend abgerechnet wird.
Die Online-Prüfung ohne Aktualisierung dauert in der Regel nicht länger als das Einlesen der eGK. Etwas mehr Zeit benötigt das System, wenn Angaben aktualisiert werden. Dafür müssen Praxismitarbeiter die neuen Versichertendaten nicht mehr händisch einpflegen, denn sie können automatisch in das PVS übernommen werden.
Vorgaben an die Hersteller der Technik sehen vor, dass die Online-Prüfung nicht länger als fünf Sekunden dauern soll, mit Aktualisierung maximal 13 Sekunden.
Bei technischen Störungen mit dem VSDM wenden Sie sich als Erstes an Ihren Systembetreuer.
Vorab können Sie ab die Verfügbarkeit der TI-Komponenten auf der Monitoring-Seite der gematik überprüfen.
Für die Tätigkeit als Belegarzt im Krankenhaus kann weiterhin das mobile Kartenlesegerät verwendet werden. In diesem Versorgungskontext ist kein VSDM-Abgleich durchzuführen und es ist keine Ausstattung mit den Komponenten erforderlich.
Poolärzte sind Nicht-Vertragsärzte am organisierten Ärztlichen Bereitschaftsdienst und
müssen kein VSDM durchführen. Eine freiwillige Anbindung an die TI ist nicht zu empfehlen, da die Finanzierungsvereinbarung derzeit keine Erstattung von TI-Pauschalen für Poolärzte vorsieht. Die mobilen Kartenlesegeräte können erst einmal weiter verwendet werden. Die Bereitschaftspraxen werden mit den erforderlichen Komponenten zur Durchführung des VSDM-Abgleich ausgestattet, d.h. in den Praxen kann das VSDM durchgeführt werden.
Notärzte müssen kein VSDM durchführen und müssen sich daher nicht an die TI anbinden.
KIM steht für Kommunikation im Medizinwesen und ist seit dem Jahr 2020 der Dienst für die zukünftige sichere, vertrauliche und barrierefreie Kommunikation im Gesundheitswesen. Der Dienst läuft innerhalb der Telematik-Infrastruktur (TI) und ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. KIM wird den heutigen Dienst KV-Connect sukzessive ablösen.
KIM ist die sichere Kommunikation zwischen allen Leistungserbringern im Gesundheitswesen und bietet folgende Vorteile:
- Vertraulichkeit der Nachrichten
- fälschungssicher durch Signatur und Verschlüsselung
- geprüfte Identität von Versenders und Empfänger
- schnelle Auffindbarkeit der KIM-Nutzer
- Abrechenbarkeit durch das sichere Übermittlungsverfahren (eArztbrief/eAU) nach § 291b Absatz 1e SGB V
Weil es die sichere Kommunikation zwischen allen Leistungserbringern ermöglicht!
Auch wenn Sie die KIM-Funktionalitäten eher selten nutzen: Ein Fax oder eine normale eMail ist nicht datenschutzkonform.
Zukünftig werden auch Anwendungen für den Datenaustausch mit KV (Abrechnung) oder Krankenkasse (bsp. Konsiliarbericht, PTV) den KIM-Dienst nutzen. Anwendungen, die bereits über KV-Connect angebunden sind, werden sukzessive nach KIM migriert.
Die Übermittlung einer Abrechnung über das KVNO-Portal mittels eToken wird weiterhin zur Verfügung stehen.
Ja. KIM dient der sichereren Kommunikation zwischen Leistungserbringern.
KIM funktioniert wie ein E-Mail-Programm in ihrem Praxisverwaltungssystem mit einer Ende-zu-Ende Verschlüsselung. Der Transport aller so gesicherten eArztbriefe und Nachrichten erfolgt über die Telematik-Infrastruktur (TI).
Auf Grund der Struktur der übermittelten eArztbriefe und eNachrichten können diese schnell und einfach in die lokale Patientenakte übernommen werden. Einscannen entfällt, Papier wird reduziert und die Rechtsicherheit bei der Archivierung von eArztbriefen ist durch die Fälschungssicherheit von KIM gegeben.
Erklärvideos zu KIM finden Sie unter folgenden Links:
- https://www.kbv.de/html/kim.php (KBV)
- https://youtu.be/q1zKMu2xCUk (gematik)
- https://youtu.be/na0SaYv-bCg (KVNO)
- Konnektor Update (Mindestens PTV3)
- Bestellen das KIM-Modul bei Ihrem Praxisverwaltungssystem-Anbieter
- Bestellen Sie die Zugangsdaten und E-Mail-Adresse für KIM bei Ihrem KIM-Dienst (Verzeichnisdienstanbieter)
-> entweder bei Ihrem PVS-Anbieter oder direkt beim KIM-Anbieter - Bestellen Sie ggf. den eHBA G2 z. B. für die Signatur bei einer KIM-Anwendung
- Reichen Sie den Pauschalenantrag ein, um die Förderung für KIM zu erhalten
Kommunikation via KIM ist zwischen allen an die Telematik-Infrastruktur angebundenen Institutionen möglich – aktuell also Krankenhäuser, Apotheken, Ärzte/ Zahnärzte, Psychotherapeuten, Körperschaften (KVen, KBV, KZVen, KZBV, Kassen, GKV-SV, ABDA und DKG). Sender und Empfänger müssen über eine KIM-Adresse verfügen.
- Zukünftig werden noch Physiotherapeuten, Hebammen oder Pflegedienste Teilnehmer der TI und damit von KIM werden.
- Nicht-Kassenärzte können – sofern sie einen eigenen eHBA besitzen – über die KIM-Adresse des MVZ eArztbriefe versenden können
- Privatärzten wird zukünftig – mit dem Anschluss an die TI – KIM ebenfalls zur Verfügung stehen.
Für die Kommunikation mit Patienten wird es ab 2023 den TI-Messenger (TIM) geben.
Über KIM werden eArztbriefe, eNachrichten und die eAUs übertragen.
Später werden die Online-Abrechnung, eDokumentationen sowie Heil- und Kostenpläne dazu kommen.
KV-Connect war nur für die Kommunikation zwischen Ärzten, Laboren und Datenannahmestellen gedacht. KIM hingegen kann von allen Leistungserbringern in der Telematik-Infrastruktur genutzt werden.
Die zur Zeit noch ausschließlich in KV-Connect vorhandenen Anwendungen werden in den nächsten Jahren nach KIM migriert (Zeitplan im Detail nicht bekannt).
Die Migration der Anwendungen erfolgt in drei Schritten:
- Arzt zu Arzt Anwendungen (eArztbrief und die eNachricht) – verfügbar
- Arzt zu KVen (Online-Abrechnung und eDokumentationen) – geplant
- Arzt zu Datenannahmestellen (eDokumentationen) – geplant
KV-Connect kann jedoch weiter genutzt werden, solange die einzelnen Anwendungen noch nicht migriert sind.
Rund 40 Anbieter für den KIM-Dienst sind auf dem Markt verfügbar. Die Dienste sind interoperabel, d.h. im Prinzip kann jeder Dienst mit jedem PVS genutzt werden.
Es empfiehlt sich aber, wenn möglich, alles aus einer Hand anzuschaffen. Fragen Sie daher bei Ihrem Systemhaus nach, welcher Anbieter hier empfohlen wird.
Alternativ bietet die KBV – auf Wunsch der Ärzteschaft – mit kv.dox eine eigene KIM-Anwendung an.
Die entsprechenden Leistungen wurden an die akquinet health service GmbH vergeben.
Der KBV-KIM-Dienst (KV.dox) ist seit Dezember 2020 verfügbar – Informationen finden Sie hier: https://kbv.de/html/kvdox.php
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:
Support Hotline: 030 4005 1188
Support Postfach: support kv.dox@kbv.de
Eine Übersicht aller KIM-Anbieter finden Sie auf dem Fachportal der gematik.
Auf jeden Fall sollte eine KIM-Adresse für die Praxis erstellt werden, damit das Praxispersonal Zugriff auf den Posteingang hat. Dazu wird diese KIM-Adresse technisch der SMC-B Karte zugeordnet. Bitte beachten Sie, wenn Sie eine neue SMC-B Karte erhalten muss die vorhandene KIM-Adresse de- und neu registriert werden!
Für einzelne Ärzte/ Psychotherapeuten kann eine persönliche KIM-Adresse erstellt werden, diese wird bei der Einrichtung dem eHBA/ ePtA zugeordnet. Bitte beachten Sie, um den Zugriff auf die KIM-Nachrichten zu erhalten muss der eHBA/ ePtA gesteckt sein.
Wenn es aus organisatorischen Gründen Sinn macht, können Sie beliebig viele KIM-Adressen bestellen. Bitte beachten Sie, dass nur eine KIM-Adresse je BSNR über die TI-Pauschalen gefördert wird.
Ja, es gibt den Verzeichnisdienst (VZD), in dem die KIM-Adressen aller KIM-Nutzer angezeigt und eingesehen werden können. Die Einsicht in den VZD ist für Sie über Ihr PVS, möglich – sobald Sie an KIM angebunden sind. Datenbasis für die Einträge sind die Angaben im Arztregister.
Innerhalb des Verzeichnisdienstes (VZD) kann nach folgenden Elementen gesucht wird:
- Suchname
- Arzt/ Praxisname
- Adresse
- Fachgebiet
- E-Mail-Adresse
- BSNR
Grundsätzlich ja, es muss aber sowohl vom KIM-Anbieter als auch vom PVS-Anbieter umgesetzt worden sein.
Ja. Mit KIM können auch Bilder versendet werden.
In der ersten KIM Version 1.0 können Dateianhänge bis zu 25 MB versendet werden und in der folge Version KIM 1.5 (geplant für 2022), können Dateianhänge bis zu 500 MB versendet werden.
Nicht abgerufene KIM-Nachrichten werden 90 Tagen vorgehalten und dann automatisch gelöscht.
Wenn Sie in Ihrer Testabrechnung (KVNO-Portal/ KV-Connect), im Regelwerksprotokoll eine Fehlermeldung zu KIM-Systemvoraussetzungen erhalten,
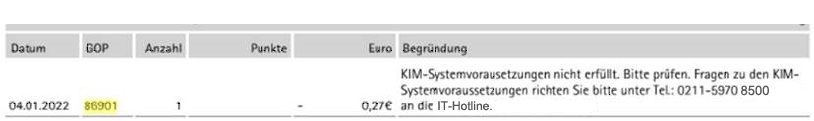
müssen Sie die Genehmigung für die abrechenbaren Leistungen und die Förderung für KIM über das KVNO-Portal unter„Services“ -> „Förderantrag Telematik“ beantragen.
Hierzu benötigen Sie Ihre KIM-Adresse, die Sie von Ihrem Softwarehaus oder KIM-Provider erhalten.
Erst mit genehmigten TI-Pauschalenantrag, können Sie KIM Leistungen wie z. B. eArztbriefe senden und empfangen abrechnen.
Der TI-Messenger (TIM) soll der schnellen, ortsunabhängigen und unkomplizierten Kommunikation zu medizinisch relevanten Themen zwischen Leistungserbringern dienen. Im ersten Schritt (geplant Ende 2022) zwischen den Leistungserbringern, später auch in der Kommunikation zwischen Praxis und Patient, werden sich die Beteiligten schnell, digital und vor allem sicher austauschen können.
Ab Sommer 2022 rechnet die gematik damit, erste TI-Messenger-Dienste zulassen können. Dafür schafft die gematik gerade die Voraussetzung: Es werden Standards entwickelt für interoperable Messenger-Anwendungen, die am 1. Oktober 2021 veröffentlicht wurden. Auf dieser Grundlage können Industriepartner dann eigene Messenger-Lösungen entwickeln und, nachdem sie von der gematik zugelassen wurden, ihren Kunden anbieten.
Nein. Der TI-Messenger ist keine Pflicht für Ärzte und Patienten.
TIM kann über das Smartphone, das Tablet oder einen Computer genutzt werden.
Die Telematikinfrastruktur der Praxis wird einmalig für die erste Authentifizierung der persönlichen Matrix-Identität benötigt.
Die zentrale TIM-Matrix (Backend) ist abwärtskompatibel (Updates). Die gematik wird einen Prozess aufbauen, wie Neuerungen kommuniziert werden sollen.
Da es bei Gesundheitsdaten um sensible persönliche Daten geht, ist das Sicherheitsniveau (Verschlüsselung, Verifikation der Teilnehmer) des TI-Messengers deutlich höher als bei anderen Diensten wie WhatsApp, Signal, o.ä,. Medizinisch relevante Informationen können daher zukünftig datenschutzkonform ohne Bedenken mit dem TI-Messenger verschickt werden.
TIM zeichnet sich durch einen von der gematik vorgegebenen einheitlicher Kommunikationsstandard aus (Matrix). Die schon am Markt befindlichen Messenger-Dienste (z. B. Siilo) sind nicht verpflichtet, auf die Matrix zu wechseln, aber nur so ist eine Interoperabilität gewährleistet. Möchte ein Hersteller nicht auf die Matrix wechseln, kann er auch nicht in den Verzeichnisdienst aufgenommen werden und ist somit im Sinne von TIM nicht interoperabel.
Aus Gründen der Akzeptanz wird vorgesehen, dass Versicherte nicht von sich aus einen Kommunikationskanal via TI-Messenger zu beliebigen Leistungserbringern eröffnen können. Die Eröffnung eines Kanals muss durch den Leistungserbringer initiiert werden bzw. erfolgen können. (Leistungserbringer zu Versicherter und Leistungserbringer zu vielen Versicherten)
Den Patienten wird TIM über die zuständige Krankenkasse im ePA-Frontend bzw. eRezept-App zur Verfügung gestellt.
Bei einem Kassenwechsel erhält der Versicherte eine neue TI-Messeger-ID, eine Übertragung des Chatverlaufes soll möglich sein.
Sobald Mitarbeiter einer Praxis (z. B. MFAs) TIM nutzen sollen, muss die Praxis einen dedizierten Homeserver einrichten. Dieser kann allerdings als virtuelle Maschine (VM) in einem Rechenzentrum stehen. Das gilt auch für psychotherapeutische Praxen, wenn die Psychotherapeutin/der Psychotherapeut nicht einen privaten TIM-Account nutzen möchte. Dafür gibt es die sog. Institutionsaccounts, für die dann ein Homeserver eingerichtet werden muss.
TIM kann auch zum innerklinischen Austausch bzw. Austausch zwischen Kliniken genutzt werden. Dafür ist die Nutzung eines zugelassenen TIM-Dienstes erforderlich.
Für Institutionen, bei denen auch das Personal TIM nutzen soll, muss ein sog. Homeserver eingerichtet werden. Die Institution authentifiziert sich mittels ihrer SMC-B, dann können alle Nutzer auch ohne eHBA G2 TIM nutzen.
TIM soll auch zur Kommunikation zwischen Kassen und ihren Versicherten genutzt werden können. Einzelheiten müssen jedoch noch geklärt werden bzw. liegen in der Hoheit der Kassen.
Nach SGB V muss der GKV-Spitzenverband die Ausstattungs- und Betriebskosten für die TI finanzieren. Die Details wurden in der „Vereinbarung zur Finanzierung und Erstattung der bei den Vertragsärzten entstehenden Kosten im Rahmen der Einführung und des Betriebes der TI“ – kurz „Finanzierungsvereinbarung TI“ – zwischen KBV und GKV-Spitzenverband geregelt.
Eine Detaildarstellung finden Sie unter KBV – Finanzierung – eine kompakte Übersicht unter TI-Finanzierungsübersicht für Erstausstattung, weitere Anwendungen und laufenden Betrieb (kbv.de)
Grundsätzlich hat jede Vertragsarztpraxis (jede genehmigte Betriebs- und Nebenbetriebsstätte) Anspruch auf Erstattung der Kosten für die erforderliche erstmalige Ausstattung und der für die TI-Nutzung relevanten Betriebskosten. Dies gilt, solange diese Praxis an die TI angeschlossen ist und das VSDM in jeder ausgestatteten Betriebs- und/oder Nebenbetriebsstätte im Sinne der Anlage 4a BMV-Ä (gültig ab 1. Juli 2017) durchführt wird.
Als Vertragsarztpraxis im Sinne der TI-Finanzierungsvereinbarung gelten die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen nach § 95 Absatz 1 Satz 1 SGB V, soweit eine eigene Betriebsstättennummer entsprechend der Richtlinie der KBV vergeben wurde (Richtlinie nach § 75 Absatz 7 SGB V zur Vergabe der Arzt-, Betriebsstätten- sowie der Praxisnetznummern).
Beantragung der Pauschalen über ein Antragsformular
Unmittelbar nach der Installation der TI und dem ersten VSDM laden Sie sich das Antragsformular herunter:
Pauschalenantrag (PDF)
Tragen Sie die BSNR/NBSNR und das Datum des ersten Versichertenstammdatenabgleichs ein und senden Sie uns das Formular per E-Mail oder Fax zu.
Die Auszahlung der Pauschalen für die Erstausstattung erfolgt frühestens acht Wochen nach Eingang des Antrages.
Die Auszahlung der Pauschalen für die Betriebskosten erfolgt dann mit der Restzahlung für das jeweilige Quartal. Die ausgezahlten Pauschalen werden zudem im Honorarbescheid aufgeführt. Zudem werden die Betriebskostenpauschalen für das Quartal der erstmaligen VSDM-Nutzung anteilig berechnet, pro nicht genutztem Monat wird die Pauschale um ein Drittel reduziert.
Wichtig: Damit die Pauschalen für den laufenden Betrieb (Betriebspauschalen, SMC-B, eHBA) jedes Quartal ausgezahlt werden können, ist es wichtig, dass die Praxis den Versichertenstammdatenabgleich auch weiterhin jedes Quartal in jeder Betriebsstätte durchführt. Die KV Nordrhein prüft auch in den zukünftigen Abrechnungen, ob der Prüfnachweis für das VSDM ersichtlich ist, und zahlt dann die Pauschalen für den laufenden Betrieb aus.
Bitte beachten Sie: Folgeanträge (TI-Anwendungen und Updates) stellen Sie bitte über das KVNO-Portal und Services -> Förderantrag Telematik.
Die Zahlung der Einmalpauschalen erfolgt jeweils einmal am Monatsende als Sonderzahlung auf die bei uns hinterlegte Bankverbindung der Praxis/des MVZs, ausschlaggebend ist der Zeitpunkt der Bescheiderstellung.
Die Zahlung der Betriebskosten erfolgt jeweils quartalsweise und ist auf dem Quartalsabrechnungsbescheid ersichtlich.
Das Einreichen von Nachweisen ist nicht notwendig. Wir überprüfen anhand Ihrer Abrechnungsdaten im nachhinein, ob Sie berechtigt waren die Pauschalen zu erhalten.
Sollte dies nicht der Fall sein behalten wir die Zahlung wieder ein.
Sie erhalten nach Abschluss der Bearbeitung einen Bescheid auf dem Postweg auf den alle Pauschalen einzeln aufgeführt werden. Im KVNO Portal können Sie den Status Ihres Antrages einsehen wenn Sie erneut das Antragsformular öffnen.
Nach Beantragung der Pauschalen erhalten die Praxen einen Folgebescheid per Post. Dieser wird ca. eine Woche nach Antragsstellung versendet.
In diesem Bescheid werden alle beantragten Pauschalen aufgelistet.
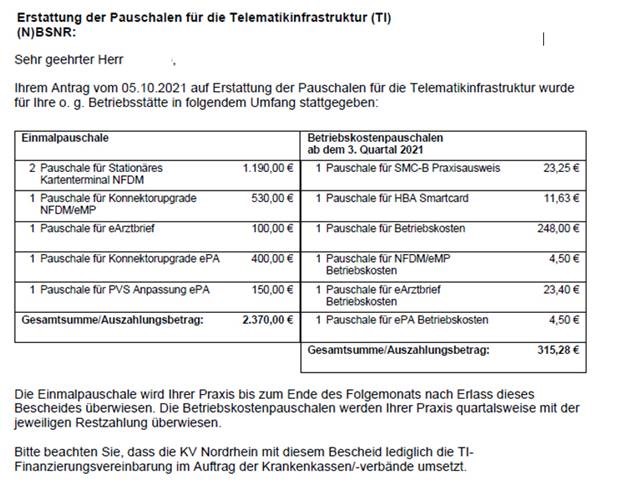
Muster Folgebescheid
Zum Ende des Quartals erhalten Praxen ein(en) Quartalskonto / Abrechnungsbescheid. In diesem können ebenfalls die aktuell ausgezahlten Pauschalen eingesehen werden.
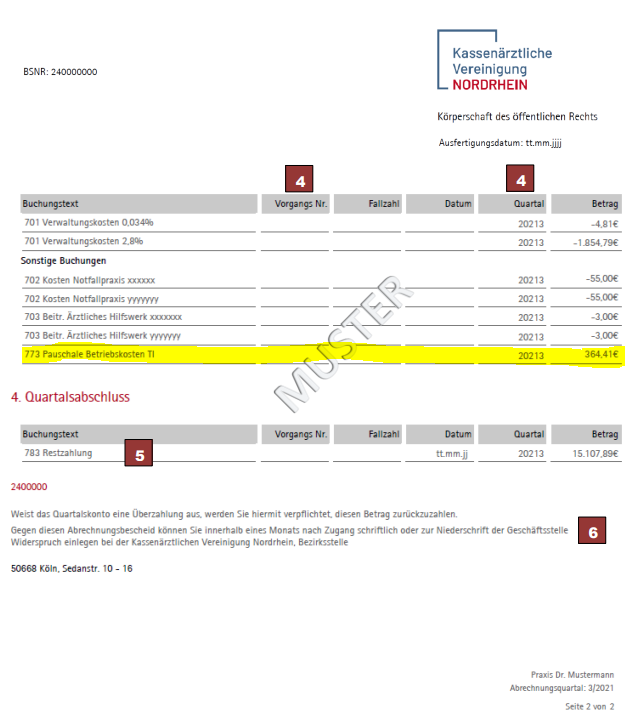
Muster Abrechnungsbescheid
Eine Leseanleitung der Abrechnungsunterlagen finden die Praxen unter folgendem Link:
Hier ist prinzipiell keine zeitliche Begrenzung bekannt.
Aber: Stellen Sie den Antrag auf die entsprechenden TI-Pauschalen nach Installation bitte zeitnah (spätestens zum Quartalsende).
Die Genehmigung des TI-Pauschalenantrags ist die Voraussetzung für eine Abrechnung der entsprechenden GOPs im Rahmen der TI-Anwendungen (u.a. KIM, ePA, eAU, eRezept).
Achten Sie auf entsprechende Fehlermeldungen in der Testabrechung.
Hier wird Ihnen weitergeholfen:
- IT-Hotline: 0211-5970-8500
- TI-Antrag.duesseldorf@kvno.de
Bei Praxisübernahmen besteht nur ein Anspruch auf Erstattung der Betriebskosten.
Die Erstausstattungspauschalen erhalten Sie nur, wenn:
- die TI-Komponenten nicht von der Vorgängerpraxis übernommen werden können
- der Vorgänger die Praxis zwar ausgestattet hat aber die Komponenten z. B. in einer anderen vertragsärztlichen Tätigkeit (am anderen Ort oder mit reduziertem Versorgungsauftrag) weiter nutzt
- der Praxisnachfolger eine Praxissoftware nutzen möchte die nicht kompatibel zu der vorhandenen TI ist
- wenn die Nicht-Übernahme begründet werden kann
Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall eine Kontaktaufnahme mit der IT-Beratung.
Nein. Eine Vorauszahlung der Pauschalen ist nicht möglich. Um nicht in Vorleistung treten zu müssen, nutzen Sie das Antragsverfahren, um die Pauschalen frühzeitig zu erhalten, und vereinbaren Sie mit Ihrem Lieferanten eine entsprechende Zahlungsfrist.
Grundsätzlich müssen keine Pauschalen zurückgezahlt werden, da Ihnen bei der Anbindung an die TI und für den laufenden Betrieb Kosten entstanden sind. Somit hatten Sie Anspruch auf die Pauschalen für die Erstausstattung und den laufenden Betrieb. Die Zahlung der Betriebskostenpauschalen endet mit der Beendigung der vertragsärztlichen Tätigkeit in der Praxis.
Wenn Sie in beiden Betriebsstätten den Versichertenstammdatenabgleich durchführen, erhalten Sie für beide Betriebsstätten die Pauschale für den Konnektor. Bei den Anbietern muss bei der Anbindung einer weiteren Praxis eventuell ein kostenpflichtiges Erweiterungspaket gebucht werden.
Die Höhe der Erstattungspauschale für stationäre Kartenterminals ist abhängig von der Anzahl bzw. dem Tätigkeitsumfang der Ärzte/Psychotherapeuten, die an der jeweiligen Betriebsstätte ihren hauptsächlichen Tätigkeitsort haben. Daraus ergibt sich ein Anspruch auf die Auszahlung der Pauschale für ein Kartenterminal je 625 Betriebsstättenfälle.
Für die Berechnung Betriebsstättenfälle wird der Durchschnitt der Q3 und Q4/2016 sowie Q1 und Q2/2017 herangezogen. Wenn eine Praxis nach dem 31. Mai 2015 zugelassen wurde, bekommt diese mind. den Fachgruppendurchschnitt. Bei Praxen die sich neu niederlassen wird ebenfalls der Fachgruppendurchschnitt herangezogen.
Informationen hierzu finden Sie unter der Finanzierungsübersicht im Punkt: Pauschale für mobiles Kartenterminal.
Vertragszahnärzte rechnen die Kosten für die Anbindung an die TI nach den Regelungen der vertragszahnärztlichen Versorgung ab (vgl. § 1 Absatz 4 der TI-Finanzierungsvereinbarung).
Bei den Voraussetzungen für mobile Kartenterminals unterscheiden sich die Regelungen der vertragszahnärztlichen und vertragsärztlichen Versorgung jedoch und sind für Vertragsärzte vorteilhafter: Während Zahnärzte 30 Besuchsleistungen oder einen Kooperationsvertrag gemäß § 119b SGB V nachweisen müssen, um eine Kostenerstattung für ein mobiles Kartenterminal zu erhalten, müssen Ärzte lediglich drei Hausbesuche im aktuellen oder Vorquartal oder einen Kooperationsvertrag gemäß § 119b SGB V nachweisen.
Um Ärzten mit einer Doppelzulassung als Vertragsarzt und Vertragszahnarzt dennoch die Möglichkeit zu geben, von den vorteilhafteren Regelungen der vertragsärztlichen Versorgung zu profitieren, hat die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) mit dem GKV-Spitzenverband eine Sprachregelung verhandelt.
Demnach können diese Ärzte einen Erstattungsanspruch für ein mobiles Kartenterminal bei ihrer KZV erwirken, sofern sie eine Bescheinigung der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung darüber vorlegen, dass sie die Ansprüche der vertragsärztlichen Versorgung für ein mobiles Kartenterminal erfüllen (§ 6 Absatz 2 Anlage 32 BMV-Ä).
MVZ und Notfallambulanzen werden über die KVen finanziert. Die bereits dargestellte Einigung auf eine eindeutige Erstattungsregelung, die auf einer überprüfbaren Rechtsgrundlage basiert, wurde in der DKG-TI-Vereinbarung übernommen.
Demnach werden MVZs, Einrichtungen nach § 311 SGB V und Notfallambulanzen nach § 75 Absatz 1b SGB V dauerhaft über die KVen finanziert (vgl. § 3 Absatz 2a). Die Abgabe einer Verzichtserklärung, mit der den betreffenden Einrichtungen zuvor eine Art Wahlrecht eingeräumt wurde, ist aus diesem Grund in den Regelungen der DKG-TI-Vereinbarung entfallen.
Die Erstattung der Pauschalen bei KV-übergreifenden überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaften erfolgt über die jeweilige zuständige KV. Liegt zum Beispiel eine Betriebsstätte in Westfalen-Lippe, so ist für die Betriebsstätte die KV Westfalen-Lippe zuständig. Für alle Betriebsstätten, die in Nordrhein liegen, erstattet die KV Nordrhein die Pauschalen.
Reisende Anästhesisten müssen sich normal an die TI anschließen. Sie erhalten nur dann die Pauschale für ein mobiles Kartenterminal, wenn sie mindestens drei Haus- oder Heimbesuche durchführen.
Dies geschieht über die DKG (Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.).
(1) Die Finanzierung der bei einem Krankenhaus durch die Einführung der Telematikinfrastruktur verursachten Investitions- und Betriebskosten bezieht sich auf Organisations- bzw. Leistungsbereiche des Krankenhauses, in denen stationäre und stationsäquivalente Krankenhausbehandlung im Sinne des § 39 SGB V einschließlich belegärztlicher Behandlung nach § 121 SGB V erbracht wird.
(2) Zusätzlich einbezogen sind folgende ambulante Organisations- und Leistungsbereiche, insoweit sich diese an einem Krankenhaus befinden oder diesem organisatorisch zugeordnet sind:
- ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b Absatz 2 und Absatz 8 SGB V
- Hochschulambulanzen nach § 117 Absatz 1-3 SGB V
- psychiatrische und psychosomatische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V
- geriatrische Institutsambulanzen nach § 118a SGB V
- sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V
- medizinische Behandlungszentren nach § 119c SGB V
- Kinderspezialambulanzen nach § 120 Absatz 1a SGB V
- Notfallambulanzen und die medizinische Erbringung von Notfallleistungen nach § 76 Absatz 1 Satz 2 SGB V, § 2 Absatz 2 Ziffer 4 BMV-Ä
- ambulantes Operieren im Krankenhaus nach § 115b SGB V
- Ermächtigungsambulanzen der persönlich ermächtigten Krankenhausärzte nach § 116 SGB V, § 4 Absatz 1 BMV-Ä, § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV
- Erbringung von ambulanten Leistungen bei Unterversorgung nach § 116a SGB V
Da derzeit Privatärzte noch nicht verpflichtet sind, sich an die TI-Anzubinden, gibt es derzeit auch noch keine Finanzierung. Nach Planungen auf Bundesebene sollen mittelfristig auch Privatpatienten die TI-Anwendungen nutzen können.